
Himba-Nomaden
Wir sind unterwegs Richtung Opuwo. Opuwo, eigentlich ein kleines Nest im Nichts, 10.000 Einwohner, Tankstelle, Supermarkt, Kneipe, Krankenstation und Bestatter. Nicht weiter erwähnenswert, wenn es nicht die „Hauptstadt“ der Himba-Nomaden wäre. Die Himba sind eines der letzten Naturvölker der Erde und hier in diesem Ministädtchen treffen die Kulturen aufeinander. Heroros, Ambos, Sans, Thwa, Ngambwe, Himbas und Touristen. Himba-Frauen gehen nur mit Lendenschutz gekleidet einkaufen, Kinder betteln, Männer lungern rum und Touristen gaffen und fotografieren. Diese Mischung ist es, dass man sagen kann: „Wer die Welt gesehen haben will, muss in Opuwo gewesen sein.“
Aber noch sind wir nicht in Opuwo, sondern draußen im Nichts, in der Wüste, im Kaokoland. Die Lager der Himba-Nomaden sind bescheiden, ein Kraal, in dem Ziegen und Rinder die Nacht verbringen, ein paar Hütten gebaut aus Ästen, die mit Kuhdung verputzt wurden und so eine windgeschützte Behausung darstellen. Fast alles was sie haben kommt aus der Natur, vor allem Kalebassen und Leder. Daraus werden Wassertröge gefertigt, genauso wie Kleidung, Schuhe und Schmuck. Alles ist überzogen mit einer angenehm riechenden, rötlichen Schicht. Das liegt daran, dass die Himba-Frauen sich mit Butterfett und einem eisenhaltigen Steinpulver einreiben, das sie vor Sonnenbrand und trockener Haut schützt. Nebenbei vertreibt es auch Moskitos. Zivilisationsmüll gibt es nicht. Erst wenn man genau hinsieht, sieht man die leeren Bier- und Schnapsflaschen. Die Himbas machen da keine Ausnahme, egal ob Aborigines in Australien, Indianer in Amerika, Pygmäen in Kongo, alle Naturvölker scheinen dem Alkohol verfallen, oder zumindest stark zugeneigt.
Mehl gegen Fotos
Wir wollen ein paar Fotos machen, wie jeder Tourist, sind uns aber bewusst, dass hier nur wenig Touristen vorbei kommen, das erfordert Geschick und vor allem Zeit.
Wir lassen die Kamera erst mal im Auto, das wir auf der Piste stehen lassen und gehen zu Fuß zu der Hüttensammlung. Kinder kommen uns entgegen und führen uns zum Familienoberhaupt. Er spricht ein paar Worte Englisch. Small Talk. Ich frage, ob ich von seinem Dorf ein paar Fotos machen kann.
„Ja, du kannst, aber du musst natürlich bezahlen.“
Natürlich, ist ja ein Naturvolk, aber in Anbetracht der vielen Bierflaschen wollen wir kein Geld geben, eher auf die Fotos verzichten. Inzwischen ist die ganze Großfamilie um uns versammelt. Mein Gegenvorschlag statt Geld: „Wir holen Mehl und Zucker aus dem Auto, soviel, das wir einen Maisbrei für alle Frauen und Kinder kochen können. Die Frauen machen Feuer und kochen und während dieser Zeit mache ich meine Bilder. Danach können wir zusammen den Brei löffeln und wir machen uns aus dem Staub.“
Der Familien-Chef ist sofort einverstanden und so komme ich zu natürlichen Fotos, ohne das sie „gestellt“ wären.
Schnaps gegen Ziege
Auf dem weiteren Weg nach Opuwo treffen wir auf Salomon vom Volksstamm der Ovambo, der hier mit seinem Auto liegen geblieben ist, Federbruch. Viel machen können wir da nicht, aber wir nehmen ihn mit in den nächsten Ort, immerhin 80 Kilometer. Fünf mal im Jahr macht er sich mit seinem schrottreifen Pick-up auf den 300 Kilometer langen Weg. Er ist Händler, bringt Bier und Schnaps zu den Himbas, tauscht den Alkohol gegen Ziegen und verkauft die Ziegen zu einem hohen Preis im Ovamboland.
Später erfahren wir, dass die Himbas erst besoffen gemacht werden und dann 1:1 tauschen, für eine Flasche Schnaps (umgerechnet 4,- Euro) eine Ziege geben.
Zucker gegen Fotos
Wir sind inzwischen in Opuwo. Hier haben sich einige Himbas niedergelassen und sind sesshaft geworden. Ein Hinweisschild weist den Weg zu einem „Himba-Schaudorf“. Ich will ein paar Bilder von Kindertragen aus Rinderleder machen, die ich in dem Dorf draußen nirgends gesehen habe. Hier im touristisch vermarktetem Schaudorf kommen jede Menge Touristen vorbei und Fotos sind kein Problem. Gegen Geld natürlich. Ich verzichte auf die Fotos, alles wirkt nicht echt. Die Frauen sitzen im Schatten und haben vor sich Decken mit Souvenirs ausgebreitet. Alles ist für das Touristenauge sauber und ordentlich aufgestellt, der Boden gefegt, aber irgendwie fehlt das Leben.
Also drehen wir um und gehen wieder. Dennoch läuft man hinter uns her und zeigt uns das „Spendenbuch“ und mir bleibt die Spucke weg, was für Beträge die Touristen hier „spenden“.
20 Euro, völlig normal, dabei ist das mehr als ein Wochenlohn.
Belehrung
„Glaubst du etwa, den Himbas macht es Spaß, sich fotografieren zu lassen?“, werde ich vorwurfsvoll gefragt, als ich die beiden Geschichten einer Entwicklungshelferin aus Deutschland erzähle.
Dabei habe ich das eher als „Geschäft“ gesehen, Fotos gegen Maismehl und nicht als Spaß. „In Deutschland wird auch keine Verkäuferin gefragt, ob es ihr Spaß macht, jeden Kunden freundlich anzulächeln, es ist einfach eine Notwendigkeit“, erwidere ich.
„In Deutschland arbeitet die Verkäuferin freiwillig.“
„Und die Himbas lassen sich freiwillig fotografieren. Die Himbas haben das Schild „Schaudorf“ geschrieben und ich frage jedes Mal, ob ein Foto okay ist.“
„Aber sie können die Tragweite, wie ihr Touristen ihr Leben verändert, nicht abschätzen.“
„Aha, da kommen also Entwicklungshelfer aus Europa, die alles wissen, und die Himbas für so blöd halten, dass sie die Tragweite des Geschäfts Mehl gegen Fotos nicht überblicken, wo sie seit Jahrhunderten Tauschhandel betreiben.“
Im Laufe des Gespräches stellt sich heraus, das sie an einem Gleichberechtigungsprojekt zwischen Mann und Frau in der Himba-Gesellschaft arbeitet.
Da frage ich mich, wer den größeren Schaden anrichtet, die Touristen mit ihren verlockenden Foto-Angeboten oder die fliegenden Händler, die Schnaps in die hintersten Hütten bringen, die Missionare, die ihnen die Erlösung bringen, oder die Entwicklungshelfer, die Bildung, Gleichberechtigung und Demokratie bringen.
Ich will hier weg
Wir halten vor einer kleinen Bretterbude. Neben der Eingangstür hat jemand das Logo von Coca-Cola gemalt und „Shop“ daneben geschrieben, dazu noch 24/24 und 7/7, also 24 Stunden am Tag geöffnet sieben Tage die Woche.
Es ist morgens 10 Uhr. In dem kleinen Dorf ist nichts los. Jugendliche stehen mit Bierflaschen vor dem Laden einige lallen uns an und betteln nach Geld, Kleidung und Essen. In dem Laden sitzen Frauen auf dem Boden, ebenfalls besoffen.
Die Lady hinter der Theke gibt mir meine Cola-Flasche (hier gibt es noch die alten 1 Ltr. Glasmehrwegflaschen) und lächelt.
„Was muss ich zahlen?“
„Willst du mich heiraten?“ Mit der Antwort habe ich überhaupt nicht gerechnet. Um nicht unhöflich mit „Nein“ zu antworten stelle ich eine Gegenfrage: „Warum?“
„Ich will hier weg.“
Himba, Krieg und Swapo
Im Unabhängigkeitskampf von Angola, in den 80zigern kämpften Swapo-Anhänger gegen die Südafrikaner, die Himba verhielten sich neutral, wollten einfach in Ruhe gelassen werden, obwohl die Kämpfe auch auf ihr Stammesgebiet übergriffen. Erst als Swapo-Kämpfer aus Angola in ihr Gebiet eindrangen und sie folterten und töteten, um etwas von den Truppenbewegungen und Stellungen der Südafrikaner zu erfahren war mit der Neutralität Schluss. Statt sich einschüchtern zu lassen, gingen sie zu den Südafrikaner und ließen sich den Umgang mit Schusswaffen zeigen. Sie beherrschten alle Waffenarten, fuhren jede Art vom Armeefahrzeug und schlugen jetzt erbarmungslos zurück. Als die südafrikanische Regierung ein Kopfgeld für jeden toten Swapo-Kämpfer auslobte, töteten die Himbas so viele von ihnen, dass sie logistisch nicht in der Lage waren, die Toten zur Zahlstelle zu transportieren. Daraufhin wurden abgehackte Hände als Entlohnungsgrundlage akzeptiert. In der Folgezeit sah man die blutverschmierten Kampfwagen mit teilweise Hunderten von abgehackten Händen angebunden zu den Zahlstellen fahren.
Als der Krieg beendet war, gaben die Himbas sofort restlos alle Waffen zurück und wendeten sich ihrem friedlichen traditionellen Nomadenleben zu.
Leider (oder zum Glück, je nach Sichtweise) hat die Swapo den Unabhängigkeitskampf gewonnen und stellt heute die Regierung in Namibia. Den Himbas hat man ihre Parteinahme für Südafrika nie verziehen und daher werden sie heute noch in Windhuk als Halbwilde bezeichnet und werden bei der Vergabe politischer Ämter und Geldmittel so gut wie nicht berücksichtigt.





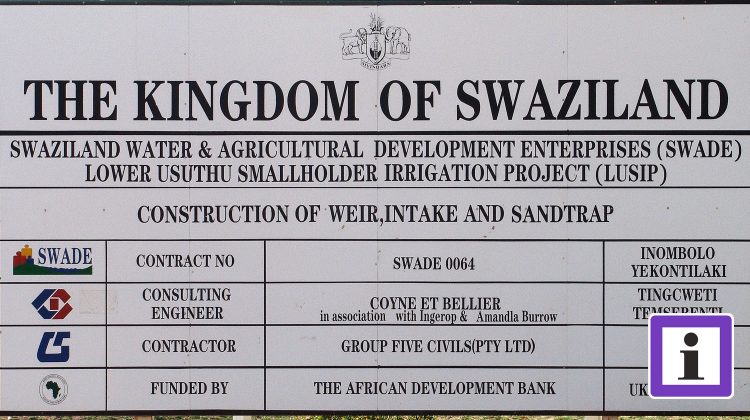






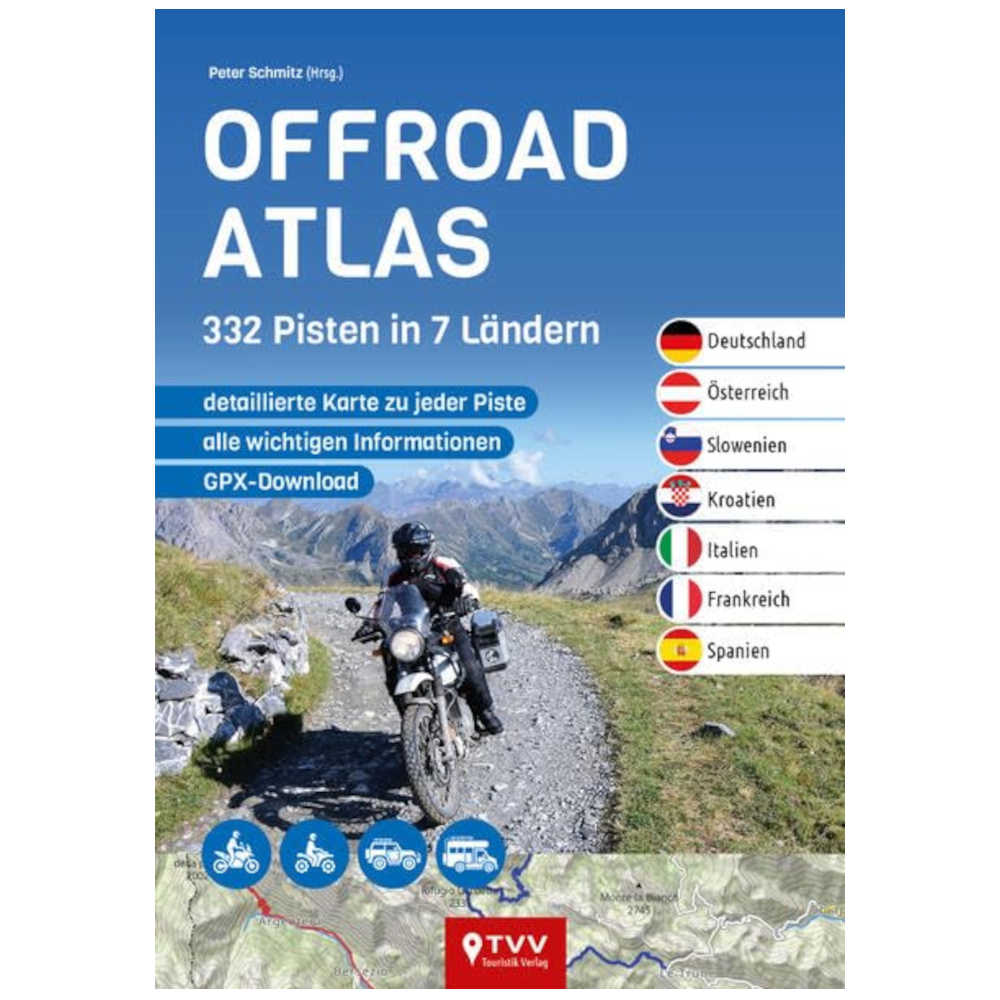





Ich finde es wirklich faszinierend, dass die Himbas, als der Krieg beendet war, sofort restlos alle Waffen zurückgaben und sich ihrem friedlichen traditionellen Nomadenleben zuwandten. Allerdings wird es einige Zeit gedauert haben, alle Opfer des Krieges zu bestatten. Eine Feuerbestattung hätte vielleicht Zeit gespart, wird aber in solch trockenen Gegenden eher gefährlich für alle Lebenden sein.