
Im Lager der Rebellen
Mit Sonnenaufgang weckt mich Frank und wir fahren in Richtung Süd-Westen aus dem Palmenwald heraus. Eine Stunde später liegen die 40 km bis Bilma hinter uns. Der Ort bietet nicht viel. Vor einem rechteckigen Lehmbau steht ein alter Land Rover, deutlich als Polizeiwagen zu erkennen. Ich öffne vorsichtig die Tür und tatsächlich, in dem kleinen Raum liegt ein Polizist in voller Montur auf seinem Feldbett und döst vor sich hin.
Er ist freundlich und nicht böse, dass wir seine verdiente Morgenruhe stören. Wir erkundigen uns bei dem gut genährten Polizisten nach der Sicherheitslage.
„Im Moment gibt es ein paar Kriminelle draußen im Sand, besonders in Grenznähe zu Tschad. Ich sorge normalerweise mit meinen beiden Helfern für die Sicherheit in einem Gebiet von 200 mal 300 km, aber unser Land Rover hat keine Batterie mehr, die ist vor zwei Monaten geklaut worden, und jetzt warten wir auf eine Neue aus Agadez. Sobald die Batterie kommt, fahren wir raus und fangen die Banditen, dann kann ich wieder für Sicherheit garantieren. Zur Zeit reiten wir die Patrouille mit unseren Dromedaren.“ Dabei zeigt er auf zwei altersschwache Tiere, die vor seinem Büro angebunden sind.
„Mit dem schrotten Land Rover vor der Tür, will der raus in die Wüste? Damit würde ich mich nicht mal bis zum Bäcker trauen, um morgens Brötchen zu holen“, flüstere ich Frank zu.
„Aber der Ort Bilma ist sicher?“, fragt Frank.
„Natürlich“, entrüstet sich der Dicke, „ich bin hier der Polizist. Ich kenne jeden Verbrecher im Ort persönlich.“
„Dann lass uns mal durch den Ort gehen“, sagt Frank zu mir gewandt, „damit wir auch mal jeden Verbrecher persönlich kennen lernen.“
Wir kaufen Brot, dazu ein paar Dosen Sardinen und fahren ca. zwei Kilometer zurück zu den Salinen von Kalala, wo seit Jahrhunderten Salz gewonnen und in der Winterzeit per Karawane durch die Wüste transportiert wird. Diese Salzkarawane ist die Einzige, die auch heute noch durchgeführt wird.
Wir laufen, gefolgt von einer Kinderschar, durch die Salinen. In unzähligen, teils quadratischen, teils recht-eckigen Becken von je etwa vier bis fünfzehn Quadratmetern Fläche, sammelt sich salzhaltiges Grundwasser. Die Becken leuchten in unterschiedlichen Farben, von dunkelrot, rostbraun über orange hin zu gelb. Andere schimmern weiß-grau, wieder andere leicht grünlich. Durch die Hitze verdunstet das Wasser und das braun-beige Salz wird an dem Rand der Becken geschöpft. Anschließend wird das Salz mit Erde vermischt und die Frauen formen es zu Laiben, ähnlich einem runden Brotlaib. Die Männer stampfen ihre Salzerdmischung zu baumstammdicken, einen Meter hohen Stangen, die dann zum Austrocknen in der Sonne stehen.
Wir verlassen Bilma in südwestliche Richtung, um auf die Piste, die über Achegour nach Agadez führt, zu stoßen. Wir wollen versuchen, die Militär- und Polizeikontrolle zu umfahren. Nicht wegen der Kontrolle, sondern wegen den Einladungen zum Tee und den Diskussionen, die uns nur Zeit rauben würden.
Unsere Orientierung war erfolgreich, und nach ca. 30 km finden wir ein Spurenbündel, das nach Westen verläuft. Das Gelände ist völlig flach und sandig. Der Sand ist äußerst weich und wir kommen nur mühsam voran. Der Dieselverbrauch steigt auf 26 Liter pro 100 km. Obwohl wir mehr als 700 km Einsamkeit vor uns haben, und nicht mit einer Streckenbesserung rechnen, dürfte es keine Probleme geben, unser 200 Liter Fass auf der Rücksitzbank gibt ein gutes Gefühl. Stunden vergehen, doch die Landschaft ändert sich nicht Alles nur topfeben und weicher Sand. Gelegentlich kreuzen Spuren von großen Karawanen unseren Weg.
Die einzige Abwechslung bringen gelegentlich verloren gegangene Gegenstände, welche von den Lkws herunter gefallen sind. Nicht selten fallen auch Schafe und Ziegen von den Lastwagen, die dann am Rand liegen bleiben und verdursten.
Die Strecke ist gut befahren. Alle vier bis fünf Stunden treffen wir auf einen Lkw-Konvoi. Die Konvois bestehen aus drei bis sechs Mercedes Lkws, die im Schritttempo hintereinander weg durch die Wüste kriechen. Gegen Sonnenuntergang erreichen wir die ersten Ausläufer des Air-Gebirges. Nach Agadez sind es nur noch 200 km.
Wir verlassen die Piste und fahren quer auf eine Gebirgs-kette im Norden zu. Am Fuß der Berge häuft sich weicher Sand, der vom Wind angeweht worden ist. Hier packe ich meinen Schlafsack aus und habe so ein bequemes Bett für die Nacht. Frank schläft, wie immer, auf dem Dachgepäckträger unseres Toyos.
Die Piste nach Agadez lässt sich schnell befahren. Vor uns tauchen die ersten runden Grashütten auf. Vor den Hütten brennen Lagerfeuer, auf denen die Frauen Hirse kochen. Ziegen und kleine Kinder laufen umher. Männer sitzen im Kreis und palavern.
Die Vegetation nimmt wieder zu. Büsche und Gräser sind höher gewachsen und wir sehen Echsen und andere kleine Tiere, die schnell im Schutz der Sträucher verschwinden, wenn wir uns nähern. Die Ténéré-Wüste liegt jetzt wohl hinter uns. Aber dafür ein Polizei-Checkpoint vor uns.
Die Polizeikontrolle ist langwierig und die Polizisten korrupt. Wir sollen Strafe zahlen, weil uns angeblich irgendein Papier fehlt. Die Strafe soll umgerechnet immerhin 50 Euro betragen.
„Fünfzig Euro! Der hat doch den Arsch auf!“
„Kosch“, so nennt mich Frank seit Algerien, wo keiner meinen Nachnamen richtig aussprechen konnte, „bleib sachlich, den kriegen wir noch runter gehandelt.“
„Der kann sich seinen Stempel … – sachlich genug?“
„Ich biete ihm mal zwei Euro an, einverstanden?“
„Nee, dem bieten wir gar nichts an, höchstens einen Tritt dahin, wo der Stempel steckt!“
„Wenn du nicht verhandeln willst, dann lass dir was anderes einfallen.“
„Gas geben und weg“, lautet mein erster Vorschlag.
„Wir sind zu dicht an Agadez, der hat wahrscheinlich Funk und seine Kollegen erwarten uns an der Stadtgrenze.“
Dann kommt mir doch noch eine konstruktivere Idee:
„Wir tun so, als würden wir das Papier suchen, aber nicht finden. Meinetwegen ziehen wir das Spielchen auch ein paar Stunden durch, irgendwann wird er sicher keine Lust mehr haben und uns fahren lassen. Wirst es sehen.“
Ich gehe zum Auto und durchwühle das Handschuhfach, dann durchsuche ich meine Klamottenkiste auf der Rücksitzbank. Nach einer Weile komme ich zurück und schicke Frank los, das Papier zu suchen.
Frank durchsucht wieder das Handschuhfach und beginnt einen gestellten Streit zwischen uns, darüber, wer denn nun das Papier zuletzt hatte und für dessen Verschwinden verantwortlich ist.
Wir streiten uns, brüllen uns gegenseitig an. Es beginnt Spaß zu machen und wir müssen uns beherrschen, nicht in Lachen auszubrechen. Von unserem Gezeter wird ein ranghöherer Polizist aus seiner Blechbude gelockt, der schließlich einschreitet und den Streit schlichtet, indem er sagt, dass das Papier nicht so wichtig sei und wir fahren könnten.
„Das ging aber schnell“, wundert sich Frank.
„Den haben wir bestimmt geweckt, der will einfach seine Ruhe und hat gar nicht mitgekriegt, dass sein Adjutant 50 Euro verdienen wollte.“
„Jetzt aber nichts wie weg.“
Der korrupte Polizist läuft neben mir her und versucht, wenigstens noch Geschenke oder Souvenirs für die Polizei rauszuschlagen.
„Ich habe nichts, was ich dir geben kann, was willst du denn haben?“
„Sonnenbrille, Radio, Fernglas, Whisky oder Bier.“
„Das haben wir alles nicht“, lüge ich.
„Dann wenigstens einen Kugelschreiber.“
„In dem Land, wo ich herkomme, ist es so, dass wir die Gäste beschenken oder wir zumindest Geschenke austauschen“, sage ich und gebe ihm den Kugelschreiber aus meiner Westentasche.
„Jetzt bist du dran. Was kannst du mir schenken, damit ich dich in guter Erinnerung behalte?“
Er meint, er habe nichts zu verschenken. Ich zeige auf sein Polizeiabzeichen und möchte dieses als Souvenir. Er lacht.
Seinen Scherriffstern will er also nicht hergeben, seine Pistole auch nicht. Ich möchte seine Polizeikappe. Er lacht, bietet mir dann seinen Kugelschreiber an. Okay, tauschen wir halt unsere Kugelschreiber.
In Agadez tanken wir voll und fahren auf den Campingplatz „Escale“, etwa vier Kilometer außerhalb der Stadt an der Straße nach Arlit. Wir sind seit Wochen die ersten Gäste auf dem sauberen und gepflegten Platz.
„Gibt es hier was zu Essen?“, fragt Frank den Manager.
„Alles, was ihr wollt, aber es dauert mindestens zwei Stunden. Wir haben nichts hier und müssen erst einkaufen.“
Wir bestellen gegrillte Fleischstücke, Brot und Tomaten. Daraufhin fährt ein Junge mit dem Fahrrad zum Markt. Zwei Stunden später bringt man uns Teller mit dem gewünschten Menü. Darauf sind die Fleischstücke leider nicht als solche zu erkennen. Ich bin mir nicht mal sicher, dass es sich überhaupt um Fleisch handelt. Der Geschmack lässt allerdings die wage Vermutung zu, dass tatsächlich ein Stück totes Tier auf meinem Teller liegt. Ich kaue auf Sehnen und Knorpel herum, Einiges ist von schwabbeliger Konsistenz, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, auf welchem Tier, oder gar auf welchem Teil eines Tieres, ich herumkaue.
Der Morgen fängt gut an: Keine Checkpoints der Polizei auf der Straße und die Piste ins Air-Gebirge finden wir auch sofort. Im Laufe des Vormittags müssen wir die Abzweigung nach Elméki verpasst haben, denn die Fahrzeugspuren auf der Piste werden immer weniger und nach einigen Kilometern verschwinden auch die letzten Spuren völlig.
„Wir sind jetzt wahrscheinlich auf der Piste nach Akrérèb“, vermutet Frank.
„Ja, wahrscheinlich. Wir können ja versuchen, quer rüber zu fahren.“
Wir fahren querfeldein durch ein trockenes Wadi, entdecken gelegentlich alte Reifenspuren im Sand und versuchen, weiter Richtung Norden zu kommen.
Ein Tuareg beobachtet uns von seinem weißen Dromedar aus und verfolgt uns eine Weile im Hintergrund. Wir stoppen und lassen ihn herankommen. Der alte Mann scheint über die Abwechslung in seinem Leben erfreut zu sein. Voller Stolz zeigt er uns sein Schwert, und ich muss unbedingt auf seinem Dromedar sitzen und eine Runde reiten. Es muss irrsinnig lustig ausschauen, wie ich mich in luftiger Höhe auf dem schaukelnden Hengst an den Sattel klammere, denn der Alte kriegt sich vor Lachen kaum ein.
Ich bin froh, endlich wieder absteigen zu dürfen. Jetzt will er eine Runde unseren Toyota fahren. Wir machen ihm klar, dass er gerne eine Runde mitfahren kann, aber auf keinen Fall darf er selber fahren.
Es dauert lange, bis er einwilligt. Schließlich sei ich ja auch alleine geritten, darum will er auch alleine fahren. Als er auf den Beifahrersitz steigt, – steigt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er setzt sich nicht, sondern hockt sich auf den Sitz –, merke ich, dass er zum ersten Mal in einem Auto mitfährt.
Ich fahre einen Kreis, dann eine Acht.
Er hat riesigen Spaß daran, lacht und freut sich, wie ein kleines Kind auf der Kirmes beim Karussell fahren. Er fasst alles an, will alles wissen. Als dann das Autoradio auch noch Musik macht, ist er ganz aus dem Häuschen. Er singt und klatscht in die Hände. Plötzlich greift er mir ins Lenkrad, erschrickt jedoch und weicht direkt zurück, als er an den Scheibenwischerhebel kommt und die Wischer ihren Dienst aufnehmen.
Noch eine Runde und noch Eine. Er will gar nicht mehr aussteigen. Ich bin froh, als er endlich genug hat und wieder auf sein Dromedar steigt.
Zum Abschied zeigt er uns die Richtung, doch der Weg eignet sich vielleicht für sein Kamel, aber nicht für unseren Toyo.
Zwei Stunden holpern wir im Schritttempo weiter durch die Landschaft. Endlich erreichen wir ein kleines Dorf. Die Dorfbewohner begrüßen uns freudig und hier treffen wir auch wieder auf Fahrspuren, die in unsere Richtung führen.
Vier Kilometer hinter dem Dorf sehen wir einen alten Berliet-Lkw, der sich im weichen Sand des Wadis festgefahren hat. Dummerweise hat der Fahrer den Motor abgewürgt und der Anlasser ist natürlich kaputt. Zehn Helfer versuchen nun schon seit drei Tagen, den Lkw auf Bohlen anzuschieben. Aus meiner Sicht ein unmögliches Vorhaben. Versorgt werden sie, wie selbstverständlich, von den Bewohnern aus den naheliegenden Hütten.
Frank überholt und stellt den Toyo auf festem Grund oberhalb des Wadis ab. Er schlägt vor, den Lkw mit Hilfe unseres Bergegurts und des Toyotas herausziehen. Ich bin gegen den Versuch, weil wir keine Chance haben, den Lastwagen aus dem Sand zu befreien, da unser Geländewagen im Verhältnis zum feststeckenden Lkw viel zu schwach ist. Vielmehr befürchte ich, dass wir unsere Kupplung und den Antriebsstrang zu stark belasten und eventuell selbst einen Defekt davontragen.
Die Gaudi der Afrikaner, welche bei unserer Ankunft freudig um uns herum getanzt sind, weicht Resignation und Betrübtheit. Also gut, ich einige mich mit Frank, dass wir einen einzigen Versuch unternehmen werden, aber sollte sich der Lkw nicht bewegen, sofort abbrechen. Sofort beginnen die Afrikaner wieder mit ihrem Freudentanz, als sie sehen, wie ich den Bergegurt aus dem Toyota hole und an ihrem Lkw befestige.
Der Gurt misst 30 m und reicht soeben. Frank legt die Untersetzung ein und zieht den Gurt stramm. Kupplung los und Vollgas. Die Räder des Toyotas drehen durch und außer schwarzem Auspuffqualm und aufgewirbeltem Staub ist vom Toyo nichts mehr zu sehen. Doch zu meiner Überraschung bewegt sich der Lkw, rollt auf die Konstruktion aus Bohlen und Sandblechen und der Fahrer startet. Mit einer mächtigen Rußwolke zeigt der Motor, dass er wieder lebt. Mit vereinter Kraft zieht unser Toyota jetzt noch die Böschung hoch, geschafft.
Die Freude der Afrikaner ist unermesslich. Während wir unsere Sandbleche und den Bergegurt verstauen, wird auf dem Holzkohlefeuer Tee gekocht, und natürlich bleiben wir zu der obligatorischen Teerunde. Die Runde ist heiter, doch wir müssen aufbrechen, die Rettungsaktion hat unser Zeitfenster stark verkleinert und wir wollen vor Anbruch der Dunkelheit in Iferouane eintreffen. Die weitere Orientierung wird wesentlich leichter, immer mehr Fahrzeugspuren bündeln sich und bilden eine deutliche Piste. Wir kommen gut voran.
„Wo ist eurer Führer?“, fragt der Polizist in Iferouane, während er in unseren Pässen die gültigen Visa kontrolliert.
„Och, der hat an der Tankstelle alte Bekannte getroffen und trinkt Tee mit denen, der wartet da auf uns“, lügen wir dreist.
„Ja, das macht der immer“, antwortet der Polizist.

Tankstelle in Iferouane
Wir sind verunsichert, ist das sein Ernst, oder hat er uns durchschaut und geht auf das Spiel ein? Wie dem auch sei, er drückt seinen Dienststempel in unseren Pass und lässt uns gehen.
Im Air-Gebirge des Niger besteht Führerpflicht. Wir sind jedoch ohne unterwegs. Auf Ärger und längere Diskussionen haben wir uns eingestellt, denn von den obligatorischen Papieren haben wir nur die internationalen Kfz-Papiere.
Eine Kfz-Versicherung muss normalerweise an der Grenze abgeschlossen werden, jedoch gibt es an der von uns befahrenen Strecke kein Versicherungsbüro.
Man braucht des Weiteren eine Fahrgenehmigung, welche wir auch pflichtbewusst in Berlin beantragt und erhalten haben, allerdings sagte der Polizeichef in Dirkou, dass diese Genehmigung nur dann gültig sei, wenn sie zuvor vom Verkehrsministerium in Niamey bestätigt, und mit deren Stempel und Unterschrift versehen wurde. Bei Unserer fehlen natürlich all diese Stempel und Unterschriften. Seitdem zeigen wir diese Genehmigung nicht mehr vor und stellen uns diesbezüglich unwissend.
Bisher sind wir bei allen Checkpoints mit viel Reden durchgekommen. Unser Argument war immer, dass man alle diese Papiere nur in Agadez besorgen könne, wir aber aus der Ténéré kämen und auf dem Weg nach Agadez seien.
„Jetzt aber nichts wie weg hier, bevor der es sich anders überlegt.“ Frank drängt zur Eile.
„Zudem steht die Sonne schon weit im Westen. Viele Kilometer werden wir heute nicht mehr schaffen.“
Und so kommt es dann auch. Wir übernachten im Wadi Tadek. In Iferouane hätte es zwar einen einfachen Campingplatz gegeben, aber dann wäre aufgefallen, dass wir ohne Führer unterwegs sind. Daher verzichten wir auch auf das abendliche Lagerfeuer, wir wollen einfach nicht entdeckt werden.
„Kosch, aufstehen, es ist hell.“
Von wegen hell, am östlichen Horizont ist ein graues Band zu erkennen. Davor die blaue Flamme des Gaskochers, auf dem Frank bereits Tee kocht. Also raus aus dem warmen Schlafsack, ab in die Kälte.
Ich bin überrascht, am Abend hatte ich den Sand schön glatt gestrichen und es mir dann darauf bequem gemacht. Heute morgen finde ich unzählige Spuren im Sand. Einige Käfer und eine Maus müssen mich besucht haben, und die Pfotenabdrucke eines Wüstenfuchses sind deut-lich zu erkennen. Ich habe von all dem nichts mit bekommen. Schade.
30 Minuten später liegt mein Schlafsack zusammen-gerollt hinten im Toyo und die Heizung wärmt uns auf. Wir fahren Richtung Ost, in eine atemberaubend schöne Landschaft. Im Süden sehen wir das violett-rötlich leuchtende Tamgak-Gebirge, mit den immer wieder eingewehten gelben Sanddünen. Die Piste wird sandiger und die Gebirgszüge wechseln ihre Farbe von rot in schwarz. Wir sind draußen beim Adrar Chiriet, und können uns an den gelben Dünen vor schwarzen Felsen kaum satt sehen, einfach traumhaft schön.
Die Zeit rast, schon steht die Sonne wieder im Westen. Versteckt in den Dünen und uneinsehbar von allen Seiten, finden wir einen idealen Lagerplatz.
Andere Fahrzeuge haben wir den ganzen Tag nicht gesehen, diesen wollen wir auch aus zweierlei Gründen aus dem Weg gehen. Erstens gilt das Gebiet als Banditen-Rückzugsgebiet und zweitens wollen wir auch Polizei oder Militär wegen der fehlenden Genehmigungen und der widersetzten Führerpflicht nicht begegnen.
Nach dem Abendessen, zu Beginn der Dämmerung, klettern wir auf eine der Dünen und haben einen weiten Ausblick in das Sandmeer der Ténéré im Osten, zu den schwarzen Felsen des Adrar Chiriet im Süden und in der Ferne zu den Umrissen des Tamgak-Gebirges im Westen. Ich hole die Schlafsäcke aus dem Wagen und Frank trägt vorsichtig, damit beim Öffnen ja kein Tropfen heraussprudelt, zwei Flaschen Niger-Bier, mit der Giraffe auf dem Etikett, nach oben auf die Düne.
Tief in den Schlafsack gemummelt sehe ich in den klaren Sternenhimmel. Kein Streulicht irgendeiner Siedlung stört. Die Sterne sehen riesig groß aus, ich meine zu spüren, wie die Erde sich unter dem Himmelszelt dreht, zu fühlen, wie ich mit der Erde durchs Weltall rase. Keine Frage, das Niger Bier muss gut sein.
Am nächsten Morgen erfreut uns ein Naturschauspiel der besonderen Art. Vom Gipfel unserer Düne sehen wir, wie die Sonne feuerrot am Horizont aufgeht und sich über die scheinbar unendlichen Wüste der Ténéré erhebt. Selbst Frank vergisst das obligatorische Teekochen am Morgen. Beim Frühstück, wie üblich Müsli mit Wasser statt Milch, besprechen wir die weitere Route:
„Wir könnten zurück nach Iferouane und weiter Richtung West nach Arlit und dann bei Assamakka die Grenze nach Algerien passieren“, erklärt Frank, während er mit dem Finger die Strecke auf der amerikanischen Fliegerkarte entlang fährt.
„Ja, Assamakka würde dann die schwerste Nuss, die wir zu knacken haben. Die Grenzer sollen ziemliche Schweine sein“, entgegne ich.
„Ich weiß, ich hatte schon vor einigen Jahren das Vergnügen. Wenn wir ohne Genehmigungen, Versicherungen und dem ganzen Scheiß dort auftauchen, ist für die korrupten Zöllner Weihnachten, richtig fette Beute.“ „Lass uns mal nach Alternativen suchen.“
„Wir könnten die Piste hoch nach Norden, nach In Azaoua nehmen, dann am Brunnen In Ebeggi vorbei, und weiter nach Tamanrasset.“
„Auf der Michelin-Karte ist bei In Azaoua ein algerisches Grenzfähnchen gedruckt.“
„Ja, aber der Grenzübergang ist seit Jahren geschlossen“, entkräftet Frank meinen Einwand.
„Gut, wenn da keiner ist, fahren wir einfach daher.“
„Ich weiß nicht, ob da ein Posten abgestellt ist oder nicht.“
„Dann lass uns doch da mal hinfahren und gucken.“
„Falls dort einer ist, der uns nicht rein lässt, können wir immer noch entlang der Grenze nach Assamakka fahren. Wir kämen dann von Norden und könnten bei den Algeriern die Einreise machen. Wir wären dann nur aus dem Niger illegal ausgereist.“
„Damit könnte ich leben.“
„Ich auch, also, abgemacht?“
„Jo.“
„Ich rechne mal aus, wie viel Diesel wir brauchen.“
„Und ich koche noch einen Tee.“
Nach knapp zehn Minuten ist Frank mit unseren beiden unverwüstlichen Edelstahltassen zurück. Der Tee duftet. Ich stelle meine Tasse neben mir in den Sand zum Abkühlen.
„Ich komme auf etwa. 700 km Strecke, das hieße, wir bräuchten 150 Liter Sprit.“
„Dann müssen wir auf jeden Fall erst zurück nach Iferouane und Diesel kaufen.“
„Iferouane liegt da hinter dem Gebirge, zeig mal die Karte, vielleicht gibt es ja einen direkteren Weg, als den außen ums Tamgak-Gebirge herum.“
„Hm, sieht nicht so aus, vielleicht hier.“ Frank zeigt mit dem Finger auf eine eingezeichnete Schlucht am Ostrand des Gebirges. „Hier könnte es klappen, wir können ja mal hinfahren und gucken.“
„Ja, versuchen können wir es ja mal.“
Inzwischen ist der Tee auf angenehme Trinktemperatur abgekühlt, wir schlürfen die Tassen aus, und packen anschließend zusammen. Auf keinen Fall dürfen wir die beiden leeren Bierflaschen vergessen, denn ohne Leergut gibt es kein Bier.
Das Vorankommen wird schwierig. Die Dünen sind nicht immer so fest wie es scheint. Oft stecken wir fest und benötigen Schaufel und Sandbleche, um uns auszugraben. Zudem werden die Dünen von Kilometer zu Kilometer höher. Endlich, wir stoßen auf ein Gassi, welches direkt unsere Richtung nimmt.
„Der Weg führt geradewegs auf die Schlucht zu.“
„Und fest ist der Untergrund auch, ideal zu fahren“, antwortet Frank.
Doch wenige Minuten später sieht es schon anders aus. „Wohl zu früh gefreut, die Düne endet direkt an den Felsen und unsere Schlucht müsste sich hinter der Düne befinden“, sage ich zu Frank.
„Das wird eine Menge Arbeit, den Toyo über die Düne zu bringen.“
„Da sind wir schneller außen herum, über den gleichen Weg, den wir auch gekommen sind.“ Doch Frank hört gar nicht mehr zu, etwas anderes hat seinen Blick auf sich gelenkt.
„Was ist da vorne?“
Wir erkennen Fahrzeugspuren, die von rechts eine Düne hinunter kommen, in unser Gassi führen und direkt vor den Felsen münden. Unsere Neugier ist geweckt.
„Das ist ja ’n Ding.“ Frank ist genauso erstaunt wie ich. Zwischen Sanddüne und Felsmassiv ist genau eine Fahrzeugbreite platz.
Wir fahren durch den Durchschlupf und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Aus der Weite der Ténéré kommen Spurenbündel und führen genau in die Felsenschlucht. Wir folgen ihnen.
Die Schlucht verengt sich. Vor der Verengung lagern Nomaden an einem Brunnen. Wir winken ihnen zu, doch sie reagieren nicht.
„Seltsam“, sagt Frank, „normalerweise winken die Nomaden immer und die Kinder kommen gelaufen und wollen Bonbons.“
„Ja, die sind schon ganz schön scheu, aber vielleicht haben die noch nie Touris gesehen.“
Wir fahren in die Schlucht. Nach einigen Metern weitet sie sich und macht einen fast 90 Grad Bogen nach rechts. Unmittelbar danach erstreckt sich ein Platz, auf dem mehr als 40 Ölfässer stehen. „Was ist denn das, ne Tankstelle? Hier?“
„Komm, wir gucken uns das mal näher an.“
Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Die 200 Liter Fässer riechen nach Diesel, sind aber alle leer.
„Lass uns mal weiter fahren.“
Die Schlucht macht erneut einen Bogen und wieder stehen wir auf einem, diesmal etwas größeren, Platz. Ich spüre mein Herz schlagen. Adrenalin wird freigesetzt. Auf dem Platz stehen mehrere Autowracks.
„Das ist alles ziemlich seltsam hier, meinst du nicht?“, frage ich Frank.
„Ja, sehr seltsam. Los, wir erkunden den Platz zu Fuß.“
„Okay, aber lass den Motor laufen und dreh schon mal in Fluchtrichtung.“
Wir steigen aus und inspizieren die Wracks.
„Alles Geländewagen, alle hier auf dem Platz geschlachtet“, kommentiert Frank.
Es liegen acht oder neun Karossen auf dem Platz verteilt, an allen Autos sind die Motoren, Getriebe, Federn und Achsen ausgebaut und abtransportiert worden. Armaturenbretter wurden rausgerissen und liegen auf dem Boden, Sitze wurden mit dem Messer aufgeschlitzt.
„Das waren mal Autos von Touristen. Einheimische würden nie solche Autos fahren, oder hast du hier schon mal einen Land Rover mit Alufelgen gesehen“, stellt Frank fest und zeigt auf den geschlachteten Landy.
„Guck dir den Toyo da drüben an, der hat Recaro-Sportsitze drin, oder da hinten den Toyota mit einem Aluminium-Dachgepäckträger und Alu-Riffelblech auf den Kotflügel, als Trittstufen zum Hochsteigen.“
Immer wieder drehen wir uns um und beobachten unser Umfeld. Nichts zu sehen. Niemand kommt.
„Guck mal, dahinten, da steht eine Hütte. Komm, die gucken wir uns mal an.“ Eine aus Bast gebaute Hütte steht gut getarnt an einem Felsen und ist vielleicht 50 m von uns entfernt.
Beim näher Rangehen bemerken wir, dass die seitliche Tür offen steht. In der Hütte stehen Säcke, gefüllt mit Datteln und Getreide. Zudem liegen jede Menge Ersatzteile auf dem Boden. Kupplungen, Bremsscheiben, Steckachsen, Tanks, Kühler, Einspritzpumpen, einfach alles, was man so braucht.
„Das sieht nicht aus wie die typische Nomadenhütte.“
„Nein, sieht aus, als sei hier das zentrale Ersatzteillager. Alles aus den geklauten Touri-Karren.“
„Was machen wir? Zurück oder weiter fahren?“
„Ich denke, hier ist keiner mehr, die hätten uns schon draußen bei der Sanddüne gehört und hier in Empfang genommen“, meint Frank.
„Aber keiner lässt säckeweise Datteln und Getreide zurück. Die kommen bestimmt zurück.“
„Hast recht, aber wenn sie sich hier in der Nähe aufhalten würden, dann würde unser Toyo in diesem Moment schon zerlegt.“
„Also weiter?“
„Wegen mir schon“, antwortet Frank.
„Wegen mir auch, bin gespannt, was in der Schlucht noch alles kommt.“
Wir gehen zum Land Cruiser zurück, drehen wieder um und fahren weiter. Die Schlucht weitet sich, wirkt nicht mehr so bedrohlich und endet nach ein paar hundert Metern in einem Talkessel.
„Schade, hier gibt es doch keine Durchfahrt nach Iferouane.“
„Lass uns mal zu Fuß die Gegend erkunden, vielleicht entdecken wir ja noch was.“
„Okay, unser Auto können wir hinter dem Felsen da drüben verstecken, man muss es ja nicht direkt sehen, wenn man hier ankommt.“
Frank fährt den Toyo hinter den Felsen und wir klettern auf ihm nach oben, um uns einen Überblick zu verschaffen.
„Frank, komm mal her, guck mal, was ich gefunden habe.“ Frank kommt gelaufen. „Was ist?“
„Hier, sieh mal, eine Feuerstelle und verbeulte Töpfe.“ Wir klettern weiter und steigen auf der anderen Seite des Felsens hinunter.
„Hier lässt es sich leben, guck mal hier!“, ruft Frank.
Frank hat einen funktionstüchtigen Brunnen entdeckt und im Schatten unter einem Felsvorsprung liegen alte Matratzen als Lagerstätte. Davor jede Menge ausgespuckter Dattelkerne. Nicht weit vom Brunnen entfernt entdecken wir eine große Feuerstelle und jede Menge Ziegen und Schafsknochen. Im Sand sind Abdrücke von grobprofilierten Schuhen zu sehen.
„Könnten Stiefel vom Militär gewesen sein“, überlegt Frank.
„Wir fragen einfach mal die Nomaden am Eingang der Schlucht“, ist meine Idee.
„Gute Idee, lass uns fahren.“
Aber die Nomaden gehen uns aus dem Weg. Erfahren können wir nichts, sie sprechen angeblich weder Französisch noch Arabisch, sondern nur Tamascheck, die Sprache der Tuareg.
„Für heute hab ich genug, komm, wir fahren zurück zu unserem Übernachtungsplatz draußen in den Dünen“, schlage ich Frank vor.
„Okay, mir reicht es auch.“
Wir fahren zunächst in unseren eigenen Spuren zurück. „Wir können versuchen, die Sanddünnen, in denen wir auf dem Hinweg steckengeblieben sind, östlich zu umfahren, vielleicht ist der Sand weiter draußen fester.“
„Das glaube ich nicht, aber wir können es versuchen“, antwortet Frank.
Wir fahren mit einem Abstand von vielleicht vier bis sechs Kilometer parallel zu unserem Hinweg. Der Sand ist weich, aber wir kommen besser durch als am Morgen. Zumindest fahren wir uns nicht fest und müssen keinen heißen Sand schaufeln. Wir unterhalten uns nicht viel, jeder hängt seinen Gedanken nach.
Ich formuliere meine Gedanken als erster laut: „Wenn das Lager nur heute verlassen war, und die zurück kommen, dann sehen die unsere Spuren und wissen das jemand da war. Dann brauchen sie nur unseren Spuren im Sand folgen und kommen direkt zu uns.“
„Mmh, das wäre doof, aber wenn die nur mal kurz auf Beutezug gewesen wären, hätten sie eine Wache zurück gelassen, nee, da kommt heute keiner mehr.“
„Ja, du hast wahrscheinlich recht, aber wenn die nun zufällig heute kommen, um ihre Ersatzteile zu holen, dann sehen sie auch, dass unsere Spuren ganz frisch sind. Oder die Nomaden verraten uns. Vielleicht waren die Nomaden ja auch die getarnten Wachen, und warum dann nicht mal kurz unseren Toyota im Vorbeigehen abzocken?“
„Die Nomaden sind die Einzigen, die uns gesehen haben. Wenn das getarnte Wachen gewesen wären, hätten die sich uns doch gleich in den Weg stellen können, dann wäre unser Toyo jetzt schon filetiert und nur das Gerippe läge noch dort im Sand.“
„Vielleicht wollen sie uns nicht im eigenen Lager überfallen, dann wäre jedem klar, wer die Banditen sind.“
„Sofern jemand übrig bleibt, der von Banditen berichten kann.“
„Aber wenn die uns hätten abknallen wollen, hätten sie es schon getan.“
„Also doch ein verlassenes Rebellenlager!?“
„Ich denke nicht, dass es für immer verlassen ist. Dann wären keine Lebensmittel mehr dort und auch die Ersatzteile hätten sie auf dem Markt in Agadez oder sonst wo verkauft.“
Die Sanddünen zu unserer Linken werden kleiner und geben einen kleinen Pass frei.
„Sollen wir versuchen, hier rüber ins Nachbar-Gassi zu kommen? Dann müssten wir schon bald an unserem Übernachtungsplatz sein.“
„Komm, probier, vielleicht klappt es.“
Frank schaltet einen Gang runter und gibt Gas. Tatsächlich, der Toyota wühlt sich den Hang hinauf. Die Dünenkuppe ist so flach und fest, das wir ohne Bedenken vor der bevorstehenden Abfahrt anhaltenden und das Gelände inspizieren können.
„Da unten sind unsere Spuren“, ruft Frank freudig, „ich kann sie ganz deutlich sehen.“
„Na dann los, Gas ist rechts!“
Der Motor heult auf und ich spüre die Beschleunigung. Bruchteile von Sekunden später spüre ich den Gurt an der rechten Schulter. Frank macht eine Vollbremsung.
„Was soll das?“
„Da unten sind zwei Spuren“, entgegnet Frank entsetzt, „die sind an unserem Übernachtungsplatz, die verfolgen uns.“
Tatsächlich, ganz klar zu erkennen, da sind zwei Autos gefahren, wir und noch jemand. Ich spüre, wie meine Halsschlagader pocht.
„Los, zurück! Schnell! Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller!“
Rückwärtsgang rein und Vollgas. Sand fliegt durch die Luft, aber der Toyo bewegt sich nicht merklich.
„Verfluchter Dreck, wir stecken fest!“ Ich springe raus, scharre wie ein Besessener mit den Händen den Sand hinter den Rädern weg. Frank macht das Gleiche.
„Los, probier rückwärts rauszukommen, ich schiebe.“
Der Toyo brüllt und bewirft mich mit Unmengen von Sand, aber er bewegt sich.
„Komm, wir sind frei“, brüllt Frank.
Ich springe ins fahrende Auto und mit einem Affenzahn geht es die Dünne hinunter. Oben verzieht sich langsam der Staub und die schwarze Rußwolke.
„Wo lang?“
„Keine Ahnung, weg hier.“
„Scheiße, Scheiße, Scheiße“, wir schreien nur noch.
Adrenalin pur.
Frank hält an: „Wir müssen klar denken, lass uns über-legen, was wir machen, jetzt keine Panikreaktionen.“ „Uns bleiben nur zwei Richtungen, Ost oder West. Im Norden ist unser Übernachtungsplatz, da werden wir erwartet. Im Süden ist das Rebellenlager.“
„Wir wissen nicht, ob der fremde Wagen zu unserem Übernachtungsplatz hingefahren, oder von dort gekommen ist“, stellt Frank fest.
„Stimmt, das wäre gut zu wissen, denn dann wäre auch die nördliche Richtung offen. Ich gehe rüber und sehe mir den Verlauf der Spuren an.“
„Warte, uns bleibt nur der Weg Richtung Westen.“
„Warum?“, frage ich erstaunt.
„Süden scheidet aus.“
„Klar.“
„Im Osten geht’s raus in die Ténéré, aber im Sand sind die uns fahrtechnisch weit überlegen. Wenn die einmal unsere Spur aufgenommen haben, gibt’s kein Entkommen.“
„Ja, aber zurück nach Iferouane ist genau das, womit die rechnen.“
„Möglich, aber selbst wenn wir raus in die Ténéré wollten, hätten wir dafür nicht genug Sprit. Und aus dem Grund scheidet auch die nördliche Richtung aus. Wir müssen zurück nach Iferouane.“
„Okay, dann ist die Entscheidung gefallen und wenn die clever sind, kennen die unseren Weg.“
„Also wieder den Dünenkamm hoch?“
„Ja, was sonst?“
Frank dreht einen weiten Bogen und wieder wühlt sich der Toyo den Hang hinauf.
„Lass mich oben aussteigen, ich suche die Gegend mit dem Fernglas ab und laufe die Düne runter.“
„Okay.“
Ich suche die Dünen ab, doch erkennen kann ich nichts. Wieder im Tal bei Frank und Toyo angelangt springe ich in den Toyo und Frank gibt Gas. Wir fahren in unserer eigenen Spur von heute morgen und der neuen Spur der Verfolger nach Süden.
„Unsere Verfolgerspur biegt ab zu unserem Übernachtungsplatz“, stellt Frank fest.
„Vorne rechts der Reifen hat kein Profil, die anderen drei sind gute Sandreifen, die nördliche Richtung wäre also auch mit genügend Diesel im Tank nicht in Frage gekommen.“
Wir verlassen unsere Spur und folgen einem kleinen Gassi in süd-östliche Richtung.
„Die Richtung ist gut. Wir kommen gleich aus dem Sand raus an den Fuß des Adrar Tamgak.“
„Auf dem Fels wird es schwer, unsere Spur zu finden oder zu verfolgen, wir wechseln dann unsere Richtung.“ „Ja, aber gleich ist es dunkel. Lass uns lieber einen Übernachtungsplatz suchen“, lautet mein Vorschlag.
„Ich wäre schon gerne aus dem Scheiß hier raus“, antwortet Frank.
„Du willst doch nicht nachts mit Licht hier rumeiern? Da sind die uns haushoch überlegen!“
„Schon klar, trotzdem wäre ich gerne hier raus.“
Eine halbe Stunde später weicht der Sand einer Kiesfläche. Je dichter wir an das Bergmassiv heran fahren, um so größer werden die schwarzen Kiesel. Kurz darauf fahren wir über eine riesige Steinplatte. Hier hinterlassen wir keine Reifenabdrucke und ändern die Richtung. Wir fahren direkt auf das Bergmassiv im Süden zu.
„Siehst du dahinten den Felsabbruch?“ Frank zeigt auf einen Felsbrocken, so groß wie ein Mehrfamilienhaus, der einige Meter vor der fast senkrechten Massivwand liegt.
„Vielleicht kommen wir über die kleinen Steinbrocken hinweg und können uns zwischen Felsbrocken und Felswand verstecken.“
„Die Idee ist gut, aber kommen wir da hin?“, frage ich kritisch, denn die Steine in der Zufahrt sind größer, als angenommen.
„Ach, klappt schon, ist doch ein Toyota.“
Und tatsächlich, der Toyo kämpft sich über die Steine hinweg. Nur zweimal kracht und schabt es unter dem Wagen, als beim Einfedern der Hinterachse der Hecküberhang auf einen Felsbrocken aufschlägt. Zu der Erinnerungsbeule an den Dieselfritzen kommen zwei weitere Erinnerungsbeulen an die Rebellenflucht hinzu. Endlich ist der Motor aus und Ruhe umgibt unseren Über-nachtplatz.
Frank wühlt in der Zargesbox nach etwas Essbarem, er ist heute mit kochen dran, dafür muss ich später den Abwasch machen.
„Was meinst du zu Reis mit Tomatensoße? Oder lieber Nudeln mit Tomatensoße, oder Reis mit Dosengulasch? Ah, wir haben auch noch Kartoffelbrei aus der Tüte.“ „Ich habe einen Bärenhunger, also viel Reis mit viel Tomatensoße.“
Wir umranden den Bunsenbrenner mit Steinen, damit auch ja nicht der kleinste Lichtschimmer durch die Dunkelheit dringt und uns verrät. Während Frank das Abendessen kocht, beobachte ich die Umgebung mit dem Fernglas, ob vielleicht irgendwo ein Lichtschein zu erkennen ist, oder eine andere Merkwürdigkeit mein Aufsehen erregt. Aber es scheint, als wären wir völlig allein.
„Essen ist fertig“, ruft Frank.
Zuhause würden wir die Pampe aus Reis, Wasser und Tomatenmark, abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und getrockneten Kräutern der Provence, nicht mal dem Hund vorsetzen, aber hier schmeckt sie erstaunlich gut und macht vor allem satt.
Der Aufwasch ist schnell erledigt, denn wir essen gemeinsam aus dem Topf, in dem auch gekocht wurde. So bleiben nur zwei Löffel und der Topf mit Sand sauber zu reiben.
Anschließend verpacken wir alles abfahrbereit und klettern den Felsen hinter uns ein Stück nach oben. Hinter einem großen Stein können wir zu zweit sichtgeschützt sitzen, und dennoch einen weiten Blick in die Richtung werfen, aus der wir gekommen sind.
„Was meinst du, ob die uns suchen?“, frage ich Frank. „Keine Ahnung, vielleicht ist das auch alles Zufall, vielleicht irgendwelche Touristen, die unsere Spuren entdeckt haben und diesen folgen, vielleicht Polizei oder Militär, weil der Polizeichef mitbekommen hat, dass unser angeblicher Führer doch nicht bei der Tankstelle gewartet hat.“
„Die werden aber nicht den teuren Diesel verfahren, um zwei Touris zu suchen, welche die Führerpflicht umgehen. Zudem haben wir angegeben, nach Assamakka zu fahren. Wenn, dann suchen die in der entgegengesetzten Richtung.“
„Mehr, als Vermutungen anstellen, können wir nicht. Das wird sich erst klären, wenn wir ihnen begegnen.“
„Danach habe ich keine großes Verlangen, ehrlich gesagt. Andere Touris werden es nicht sein, und alles andere wird unangenehm für uns.“
„Unangenehm ist es auch so schon. Irgendwo da draußen kurven welche rum, die vielleicht hinter uns her sind, und…“
Von einem Augenblick zum Nächsten ist alles anders. Mit einem Mal versagt die Stimme, alle Sinne richten sich nach der Dunkelheit. Verdammt, da war doch was? „Achtung, da hinten sind zwei Scheinwerfer. Die kommen auf uns zu!“
„Scheiße, die kommen, warum sind die so nahe, warum haben wir nicht gehört?“
Im Dunkeln ist es schwer zu schätzen, aber die Lichter sind nicht irgendwo am Horizont, sondern vielleicht nur einen Kilometer von uns entfernt.
Frank springt auf und stürmt den Abhang hinunter. Ohne viel Nachzudenken renne ich hinterher. Frank reißt die hintere Tür auf und zerrt seinen Schlafsack raus.
„Was hast du vor?“, will ich wissen.
„Den über die Frontscheibe werfen, damit irgendwelche Lichtreflexionen uns nicht verraten. Mach was mit den Scheinwerfern!“
An meinen Schlafsack komme ich auf die Schnelle nicht ran, er liegt zusammengerollt und mit zwei Gurtbändern verschlossen auf der Rückbank. Ich ziehe die Jacke aus und hänge sie vor den rechten Reflektor. Meinen warmer Pullover vor den Linken. Jetzt ist auch schon das Motorengeräusch deutlich zu hören. Es kommt näher. Frank liegt auf dem Autodach und hält den Schlafsack fest, damit er nicht runterrutscht.
Das Motorengeräusch ändert sich. „Jetzt muss er auf der Felsplatte sein“, flüstert Frank.
Wir sehen den Lichtkegel an der Felswand entlang streifen. Das Fahrzeug kommt noch näher. Sie müssen jetzt genau vor dem uns schützenden Felsbrocken sein. Wir sind absolut still, doch trotzdem habe ich Angst, dass mein schnell und laut pochendes Herz uns verraten könnte.
Das Auto fährt vorbei. Die Sekunden kommen mir endlos vor. Der Lichtkegel verschwindet und das Brummen entfernt sich. Die Anspannung fällt schlagartig von uns ab und sofort stellt sich ein Gefühl der Freude ein.
„Die haben uns nicht gesehen, solche Trottel“, lacht Frank.
„Sag nicht Trottel, dass war die Spezialeinheit des nigrischen Militärs“, entgegne ich während ich mir wieder Pullover und Jacke anziehe.
Minutenlang lästern wir über unsere Verfolger, wobei wir noch nicht mal wissen, ob es überhaupt Verfolger gibt. „Ich koche noch einen Tee, kannst ja schon hoch zu unserem Ausguck gehen“, sagt Frank.
„Kannst ja zwei Tassen mehr kochen, falls die zurück kommen, dann laden wir sie auf einen ‚Herzlich-Willkommen-Tee’ ein.“
Fünf Minuten später ist auch Frank mit dem heißen, starken und süßen Tee bei unserem Aussichtsplatz. Der Sternenhimmel ist klar, der Orion ist deutlich zu erkennen. Der Polarstern steht tief am nördlichen Horizont. Keine andere Lichtquelle ist auszumachen. Nicht der Schein eines Lagerfeuers, kein Leuchten einer Oase und vor allem keine Autoscheinwerfer.
„Ich schlafe heute hier oben, wo schläfst du?“
„Ich penne auf dem Dachgepäckträger, wie immer“, antwortet Frank.
„Wenn die Sonne uns weckt, brechen wir auf.“
„Okay.“
„Oder wir stellen uns den Wecker, dann fahren wir in der Dämmerung ohne Licht und werden nicht so leicht gesehen.“
„Gute Idee, dann stelle ich mal den Wecker auf vier.“
„Was, so früh! So gut war die Idee nun auch wieder nicht.“
„Nee, lass mal, vier Uhr ist gut, dann trinken wir in Ruhe einen Tee und sobald wir die Piste erkennen können, geht’s los.“
„Okay, ich hol meinen Schlafsack und Isomatte, und dann war für mich der Tag lang genug.“
Es ist stockdunkle Nacht.
„Hey, aufwachen, Tee ist fertig.“
Ich beneide Frank, ihm macht es scheinbar nichts aus, aus dem warmen gemütlichen Schlafsack zu kriechen. Ich tue mich da deutlich schwerer. Aber immerhin brauche ich keinen Kaffee kochen, das übernimmt Frank freiwillig jeden Morgen.
Der östliche Horizont färbt sich grau. Die Steine und Fahrspuren sind immer deutlicher zu erkennen. Frank startet den Motor und lässt ihn einige Minuten warm laufen, während ich die Edelstahltassen mit einem winzigen Schluck Wasser ausspüle.
Nach einer halben Stunde treffen wir auf eine deutliche und gut zu befahrende Piste, welche wenig später in die Hauptpiste mündet, auf der wir gekommen sind. Am Brunnen Tadeida tränken Nomaden ihre Ziegen und eine Stunde später kommen wir an die ersten verstreuten Hütten der rettenden Ortschaft Iferouane.
„Lass uns doch erst was frühstücken, bevor wir zur Tanke fahren und am Brunnen Wasser holen“, bettelt Frank.
„Da vorne, das Café auf der linken Seite sieht doch brauchbar aus.“
Der Besitzer liegt im Schatten seiner Bretterbude, welche die Küche darstellt. Er hat schon lange keine Gäste mehr bewirtet und ist überrascht, weiße Europäer hier zu sehen.
Das Café scheint neu zu sein. Die Stühle sind aus Holz, teilweise zwar schon kaputt, aber zwei Brauchbare lassen sich auftreiben. Dafür ist der Platz relativ sauber und einige Dattelpalmen sind neu angepflanzt. Diese spenden zwar noch keinen Schatten, aber in einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ist es bestimmt ein schöner Platz, sofern man ihn dann immer noch sauber hält.
Frank kommt von der Küche zurück und teilt mir das Ergebnis der Unterhaltung mit dem Chef mit.
„Zu essen hat er nichts, aber er kann was besorgen. Sollen wir es auf einen Versuch ankommen lassen?“
„Meinetwegen, eine Chance soll er haben.“
„Rührei mit Brot, das müsste er schaffen mit dem, was es hier zu kaufen gibt.“
„Okay, dann bestell mal Rührei aus sechs, ach Quatsch, acht Eiern und frisches Brot dazu.“
„Und eine große Kanne Tee.“
Der Alte grinst und freut sich sichtlich über die Bestellung. Einer seiner Söhne muss Eier und Brot besorgen, der ältere Sohn macht Feuer und kocht den Tee. Später wird auf dem Feuer unser Rührei gebraten.
Das Ei schmeckt gut und das Brot ist noch richtig heiß, ebenso der süße Tee. Wir unterhalten uns mit dem Besitzer.
„Wenn ihr wieder hier vorbei kommt, ist mein Café ein großes Hotel geworden, mit vielen Zimmern, großer Empfangshalle und einem großen Restaurant in einem schönen grünen Garten.“
„Wann wird es soweit sein?“, frage ich ungläubig.
„Inschalla, wie Gott will, aber erst müssen die Palmen groß werden.“
Dann legt er sich wieder in den Schatten und wartet, dass die Palmen wachsen. Wir sind froh hier zu sein, kein Stress, von den Verfolgern mal abgesehen, einfach Ruhe.
Das ändert sich, als wir das Café verlassen. Inzwischen hat es sich rumgesprochen, dass Touristen in der Oase sind. Souvenirhändler warten am Ausgang des Cafés auf uns. Viele haben einen kleinen Teppich ausgerollt, auf dem sie all ihre Waren anpreisen. Hauptsächlich Silber-schmuck, Schwerter und Dolche. Hinzu kommen unzählige Kinder, die nach Kugelschreibern, Bonbons oder am Besten gleich nach Geld betteln.
Und natürlich umkreisen uns wieder Hunderte von Fliegen, die den Kindern und Händlern in ihrer Aufdringlichkeit in nichts nach stehen.
An der Tankstelle kaufen wir ein 200 Liter Fass Diesel und pumpen es in den Haupt- und Zusatztank unseres Toyos. Es gibt keine Zapfsäulen, sondern nur Fassware, die normalerweise in 20 Liter-Kanister und 1Liter-Flaschen umgepumpt wird, genau wie beim Diesel-Schmuggler in Dirkou. Natürlich will auch hier, wie in allen Oasen, jeder wissen, woher und wohin wir fahren, aber wir verraten nichts. Assamakka ist unser offizielles Ziel. Woher wir kommen? Aus Agadez natürlich!
Anschließend fahren wir zum Brunnen. Junge Frauen waschen Wäsche, andere ziehen immer wieder den schweren Wassersack, gefertigt aus einem alten Autoreifen, aus der Tiefe und füllen das Wasser in Kanister, die sie auf ihren Eseln festgebunden haben. Wir sind die Hauptattraktion und werden verstohlen begutachtet, dabei wird geflüstert, gekichert und gelacht.
Gegen Mittag sind alle Vorräte aufgefüllt und wir machen uns auf den Weg in Richtung In Azaoua. Wir umfahren den Polizeiposten, denn noch mal wird er uns die Geschichte mit dem wartenden Führer an der Tanke nicht abnehmen, und dann heißt es für uns einige 100 km entspannt in Richtung Nord-West.







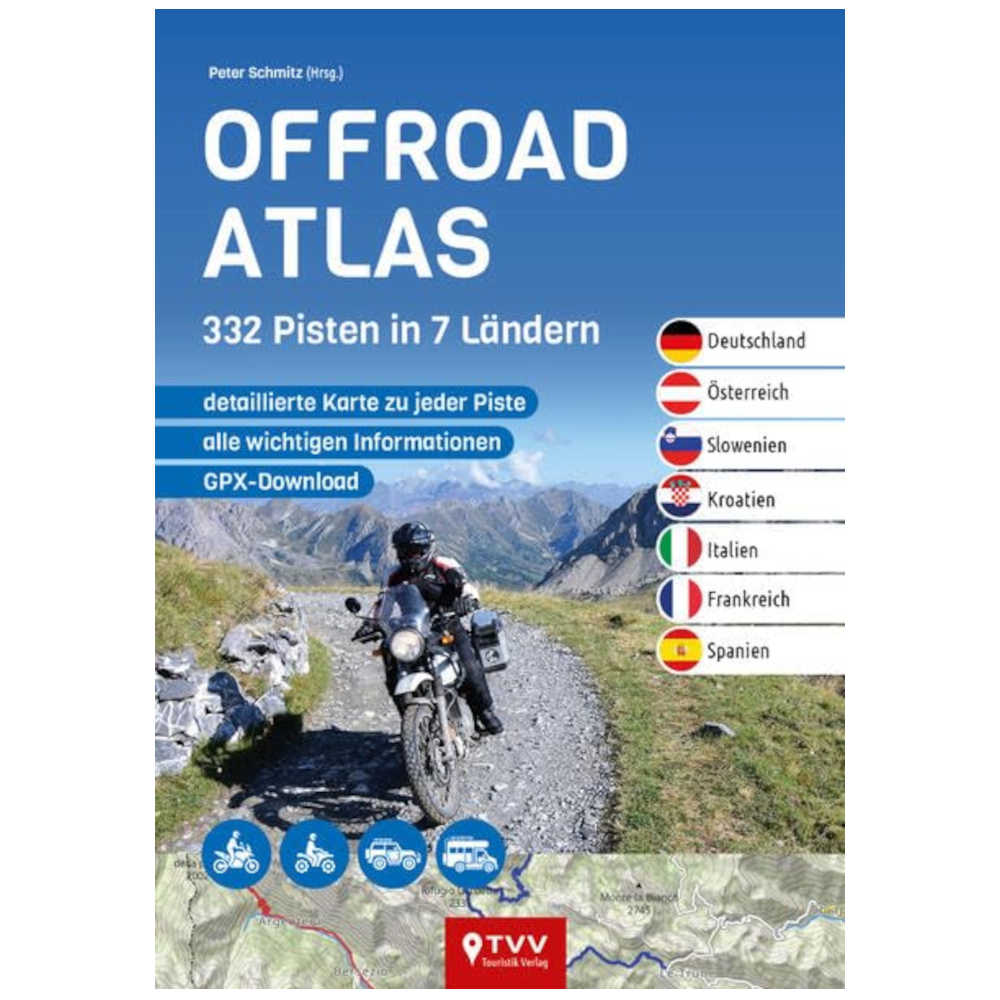






Hallo Burkhard, vielen Dank für die Veröffentlichung des Buches „Knast, Puff und Rebellen“. Die Geschichte ist spannend geschrieben. Ich bin schon auf allen Kontinenten der Erde gereist, doch in diesen Regionen kenne ich mich nicht aus. Gefühlt habt Ihr viel riskiert und oft Glück gehabt. Toll, dass ich Euch dabei begleiten durfte!
Hallo Burkhart
Was für Erlebnisse. Danke für diese lebhafte Erzählung. Trotz der momentanen Stresssituationen, am Ende sind das die Augenblicke, die nur das echte Leben schreibt. Unvergesslich und als Erfahrung abgespeichert.
Danke, das Du uns, an Deinen Abenteuern teilhaben lässt.