
Fast verreckt
Die ersten Sonnenstrahlen wecken mich. Ich liege in meinem Schlafsack neben dem Toyota im Wüstensand. Es ist kalt und in meinem Schlafsack so schön warm, ich will gar nicht aufstehen. Ich höre das Fauchen des Bunsenbrenners, auf dem Frank schon Teewasser aufge-setzt hat. Dies ist unsere zweite gemeinsame Wüstentour. Diesmal führt die Route uns von der Oase Djanet in Südalgerien nach Bilma in Niger. Von dort soll es quer durch die Ténéré-Wüste nach Agadez gehen und am Ostrand des Air-Gebirges wieder zurück nach Tamanrasset, in Algerien.
Die Unternehmung ist nicht ganz ungefährlich. Räuberbanden haben in dem Gebiet wiederholt Reisende überfallen, ausgeraubt und die Geländefahrzeuge gestohlen.
Aber nicht nur das eine Risiko droht, zudem sind wir allein unterwegs, denn es fand sich niemand, der die Reise mit uns antreten wollte. Zwei Fahrzeuge wären natürlich besser gewesen, denn wir haben ca. 700 km einsame Wüste bis Dirkou vor uns und von Dirkou sind es nochmals 700 km durch die Ténéré nach Agadez. Außer mit Banditen und Schmugglern ist mit niemandem zu rechnen. Im Falle eines technischen Defekts am Fahrzeug werden wir auf uns selbst angewiesen sein. Aber es ist wie es ist.
Die Zollformalitäten haben wir am Abend vorher schon in Djanet erledigt und sind noch ca. 30 km in Richtung Süden aus der Stadt heraus gefahren. Hier liege ich nun im feinen Sand. Keiner soll unsere genaue Aufbruchszeit wissen. Wer einen Überfall plant, soll es nicht zu leicht haben.
Während ich den heißen Tee schlürfe, schleichen sich die Erinnerungen an die vergangenen vier Tage in meine Gedanken. Sabine hatte mich nach Frankfurt zum Flughafen gebracht und mit dem Flieger ging es für mich innerhalb von 2 ½ Stunden nach Djerba in Tunesien, wo mich Frank mit seinem vollgetankten Toyota Land Cruiser HJ 61 schon erwartete.
In den darauf folgenden Tagen ging es durch sehr langweilige Landschaft nach Hassi-Messaoud in Algerien, wo wir uns für die nach Osten verlaufende Strecke Richtung El Borma entschieden, da sie uns landschaftlich reiz-voller erschien, als die gute und direkte Verbindung über Bordj Omar Driss.
Hier konnten wir üben, im Sand zu fahren, denn große Teile der ursprünglichen Teerstraße waren mit Dünen zugeweht und nur mit Allradantrieb zu bewältigen. Überall verzweigten Spuren und Pisten von Ölgesellschaften, die hier Probebohrungen durchführten oder Pipelines verlegten.
Das brachte uns auf eine der besten Ideen der Reise:
Der Land Cruiser hatte einen 80 Liter Dieseltank und Frank hatte einen 130 Liter Zusatztank eingebaut, was eigentlich als ausreichend betrachtet werden konnte, da der Toyota auf Teer ca. 15 Liter pro 100 km verbraucht und wir auf Sandpisten mit ca. 20 Litern rechneten. So hatten wir eine Reichweite von ca. 1000 km im Gelände. Am Straßenrand oder bei Bohrtürmen findet man zahlreiche leere 200 Liter Ölfässer. Von diesen wollten wir uns eines auf den Dachgepäckträger binden und als „Ersatzkanister“ benutzen.
Gesagt, getan. Schon war unsere Tankkapazität verdoppelt. 400 Liter Diesel konnten jetzt gebunkert werden. Genug für Distanzen von bis zu 2000 km.
Zwei Tage später gegen Mittag erreichten wir die Oase Djanet im Südosten Algeriens. Die Landschaft war beeindruckend. Bizarre, freistehende und zu seltsamen Formen erodierte Felstürme, wohin man sah. Einfach grandios.
Gestern haben wir den Toyota randvoll getankt und alle Formalitäten bei Polizei und Zoll für die Ausreise aus Algerien erledigt. Die Zollprozedur und das Papiere stempeln zogen sich fast 3 Stunden hin, da der Mann mit dem Stempel schon Feierabend hatte und extra wegen uns noch mal gesucht werden musste.
„Trink deinen Tee leer, du bist hier nicht im Büro, wo du dich den ganzen Vormittag an der Tasse festhalten kannst.“ Frank reißt mich aus meinen Gedanken.
Ich rolle meinen Schlafsack zusammen und werfe ihn auf die Rücksitzbank, alles andere hat Frank schon verstaut. Abfahrt.
Die Orientierung fällt nicht schwer, die Franzosen haben vor 50 Jahren, als Algerien und Niger noch französische Kolonien waren, die Piste mit Eisenstangen markiert. Diese Stangen stehen noch heute im Abstand von fünf Kilometern im Wüstensand, wenn auch nicht mehr vollzählig. Fahrzeugspuren folgen der Markierung, aber diese Spuren sind schon deutlich verweht, wahrscheinlich ist hier schon seit Wochen, oder gar Monaten, niemand mehr unterwegs gewesen.
„Frank, wir sollten besser nicht den Spuren und der Markierung folgen. Vielleicht gibt der Zöllner den Räubern Tipps gegen Beutebeteiligung, und informiert sie, wann sich Fahrzeuge auf den Weg machen. Die Banditen würden damit rechnen, dass wir den Spuren folgen. Sie bräuchten nur auf uns warten.“
„Ja, wir könnten einige Kilometer weiter westlich fahren, sodass wir von der Piste aus nicht gesehen werden. Aber dann müssten wir die Orientierung selbst übernehmen.“
„Das wäre das kleinere Übel. Und wir sollten umdrehen, die Piste in einem spitzen Winkel verlassen und dann einen weiten Bogen fahren, damit mögliche Verfolger nicht erkennen können, dass wir uns von der Markierung gelöst haben.“
Zur Navigation benutzen wir ein GPS-Gerät, das uns jederzeit die exakten Koordinaten unseres Standorts liefert. Gibt man die Koordinaten des Ziels in das GPS-Gerät ein, errechnet es automatisch den Kurs. Mit Landkarten sind wir ebenfalls gut ausgestattet. Wir haben amerikanische Fliegerkarten und französische IGN-Detailkarten im Maßstab 1:250.000 dabei.
Die Landkarten habe ich in DIN-A4 große Teile zerschnitten und in Klarsichthüllen in einen Ordner gesteckt. Dann die einzelnen Blätter durchnummeriert und die Übergänge bezeichnet. So kann ich die Karten wie einen Straßenatlas benutzen, ohne ständig auf dem Beifahrersitz mit den riesigen Karten hantieren zu müssen.
Wir fahren ca. fünf Kilometer genau 270 Grad nach West und ändern dann die Richtung auf 150 Grad Richtung Süd-Süd-Ost.
Der Untergrund ist sandig, aber fest und gut zu befahren, zumal wir den Luftdruck in den Reifen auf 1,6 Bar reduziert haben. Spuren gibt es hier keine und wir haben ein Gefühl von Freiheit. Dennoch sind wir aufmerksam. Frank konzentriert sich auf das Fahren, ich kontrolliere den Kurs und suche die Gegend nach Fahrzeugspuren ab. Plötzlich sehe ich, wie sich östlich von uns etwas bewegt.
„Hey Frank, da hinten war was!“
„Wo? Was?“
„Links von uns, ich hab’s nicht erkennen können. Vielleicht eine Gazelle, vielleicht auch nur eine alte Plastiktüte, die vom Wind davon getragen wird. Vielleicht auch das Spiegeln einer Autoscheibe in der Sonne, ich weiß es nicht.“
Frank lässt den Toyo ausrollen und kurbelt die Seitenscheibe runter.
„Im Handschuhfach liegt das Fernglas, gib mal her.“
„Und, siehst du was?“
„Nee, nichts.“
„Lass mich mal gucken.“
Wir suchen die östliche Richtung gründlich ab, aber entdecken können wir beide nichts.
„Da war nichts, du hast dich geirrt. Wohl doch zu schwache Nerven, was?“, grinst Frank.
„Ja, kann sein, vielleicht hast du recht“, lenke ich ein und ignoriere die Bemerkung. „Aber was ist, wenn nicht und da ist wirklich jemand?“
„Lass uns mal überlegen. Im schlimmsten Fall verfolgt uns jemand und im allerschlimmsten Fall sind es Banditen. Wenn es Banditen sind, dann würde ich lieber hier überfallen werden, als in ein oder zwei Stunden. Jetzt könnten wir noch die 30 oder 40 km zum Flughafen von Djanet zurück laufen, falls sie uns den Toyo wegnehmen. In zwei Stunden sind es bestimmt schon 100 km, oder mehr“, mutmaßt Frank.
„Wahrscheinlich ist da wirklich nichts, aber wenn wir jetzt nicht hinfahren und uns davon überzeugen, werden wir immer das Gefühl haben, verfolgt zu werden.“
„Gut, wir drehen um und fahren auf den Punkt zu, den du gesehen hast.“
„Okay, dann mal los. Dahinten rüber, zu dem einzeln im Sand liegenden Felsbrocken.“
Wir sind auf ca. 300 m an den Felsen heran gefahren, als Frank plötzlich losschreit:
„Dahinten, neben dem Felsen, da liegt einer im Sand!“
„Das ist ein Trick“, schreie ich zurück.
„Los, zurück. Vollgas Richtung Nord!“
Frank schaltet einen Gang runter, gibt Gas und reißt das Steuer rum. Der Toyota beschleunigt merklich, der Drehzahlmesser ist kurz vor dem roten Bereich und die Tachonadel nähert sich der 70. Der Untergrund ist eben, kein Graben, kein Kamelgras kann uns gefährlich wer-den. Man könnte hier mit über 100 Sachen durch den Sand pflügen. Ich beuge mich zum Seitenfenster heraus, um zu sehen, ob uns jemand verfolgt.
„Und, ist da einer?“, will Frank wissen.
„Nein, zumindest kann ich nichts erkennen. Ich glaube, da ist keiner hinter uns her.“
Frank nimmt den Fuß vom Gas und lässt den Toyo im zweiten Gang mit niedriger Drehzahl dahinbrummen.
„Und jetzt? Was machen wir?“, fragt Frank. Die erste Aufregung legt sich wieder.
„Keine Ahnung, was ist das für einer? Was macht der da? Meinst du, der braucht vielleicht Hilfe?“
„Die Fragen klären wir nur, wenn wir noch mal hin-fahren.“
„Lass uns vorher überlegen, was wir tun.“
„Wir fahren in unseren eigenen Spuren zurück, dicht auf den Felsen zu. Wenn es doch ein Hinterhalt ist, können wir noch nach Westen ausweichen, nach Norden drehen und zurück nach Djanet fahren. Wenn wir doch keinen Hinterhalt erkennen, fahren wir erst mal vorbei, drehen ein Stückchen weiter noch mal um und gucken dann, was wir machen können. Was meinst du?“
„Okay, einverstanden. Also zurück?“
„Ja.“
Frank dreht den Wagen und mit jedem Meter, den wir wieder auf den Felsbrocken zufahren, steigt die Spannung.
„Da, ich sehe ihn, da liegt einer!“
„Ich fahr erst mal vorsichtig dran vorbei.“
„Halt genug Abstand, falls der ’ne Knarre hat.“
Der Mensch steht auf und sackt sofort wieder in sich zusammen.
„Hast du das gesehen? Der ist kurz vorm Ende.“
„Ja, aber fahr trotzdem weiter, es kann auch ein ganz gemeiner Trick sein.“
Frank tritt das Gaspedal weiter durch.
„Und? Siehst du was? Tut sich da was?“
„Nee, der liegt wieder im Sand, sonst sehe ich nichts.“
„Dann dreh ich wieder um?“ Das war keine Frage, eher eine Feststellung.
„Okay, aber fahr nicht zu dicht ran. Lass mal ruhig 50 m Abstand, ich steige aus und geh’ zu ihm hin, du bleibst im Auto. Wenn das ein Hinterhalt ist, bretterst du einfach mit dem Toyo da rein und holst mich da raus!“
„Klar.“
Frank stoppt den Wagen wie abgesprochen in Fluchtrichtung, 50 m vor dem Mann, der jetzt im Sand kniet. Ich steige aus und gehe auf den Mann zu, während Frank im Toyota bleibt und die Situation beobachtet, alles wie abgesprochen.
Ich gehe langsam, bin hellwach, voll konzentriert und beobachte alles ganz genau. Es ist ein Schwarzafrikaner, kurze Haare, zerfetztes weißes Hemd und zerrissene Jeans, keine Schuhe. Nur eine schwarze Plastiktüte liegt vor ihm. Ich spüre, wie meine Halsschlagader pocht und kann das Blut in meinen Ohren rauschen hören. Der Mann, Mitte 20, greift in die Plastiktüte. Ich bin noch fünf Meter von ihm entfernt.
„Scheiße, der hat ’ne Knarre!“, geht es mir durch den Kopf. „Das war alles ein Trick.“
Ich bleibe stehen, die Hand in der Jackentasche, das Tränengas griffbereit. Aber was will ich mit Pfefferspray gegen eine Wumme machen? Ruckartig zieht er seine Hand aus der Tüte und wirft Geldscheine vor mir in den Sand.
„Help me, please, water, water, help me!” Er holt zwei weitere Bündel Geldscheine, mit Gummiringen zusammengebunden, aus der Tüte und wirft sie vor mich. Die Tüte ist jetzt leer und der Wind weht sie davon. Dann bricht er wieder zusammen. Ich wundere mich, er spricht englisch und nicht französisch, wie die Leute in Algerien oder Niger.
Wo kommt der her? „Frank, bring meine Wasserflasche – schnell, der krepiert!“
Die Geldscheine werden ebenfalls vom Wind erfasst, ich renne hinterher und sammele sie ein. Als ich sie ihm zurück geben möchte, will er sie nicht annehmen. „I need only help.“ Es sind einige hundert US-Dollar, ein Bündel CFA, die Währung der französischen Länder Westafrikas, und ein Bündel einer Währung, die ich nicht kenne.
Frank fährt langsam mit dem Toyota bis auf zehn Meter an uns ran, steigt aus und reicht mir meine Wasserflasche, eine alte PET-Colaflasche.
Der Toyota steht mit laufendem Motor und geöffneten Türen in Fluchtrichtung hinter uns. Ich gehe dichter an den Verdurstenden heran. Als ich mich bis auf einen Meter genähert habe und ihm die Wasserflasche geben will, macht der Mann plötzlich einen Satz nach vorne und ergreift mein Bein. Ich erschrecke, weiche zurück und brülle. Frank ist ebenfalls geschockt, alles sieht nach Angriff aus. Frank springt auf ihn zu und stößt ihn zu Seite, er fällt sofort wieder regungslos in den Sand und bleibt liegen. Zu seinem Glück, so konnte ich meinen Fußtritt noch abbremsen. Da hat er noch mal Glück gehabt. Er kommt wieder zu sich und erklärt die Situation. Er wollte mir nur die Füße küssen, aus Dankbarkeit.
Seine Dankbarkeit hätte ihm ganz schön gefährlich werden können.
„All, what you’re going to do, make it realy slowly“, ermahnen wir ihn eindringlich. Er nickt.
Ich gebe ihm meine Wasserflasche, er leert sie gierig in einem Zug, den ganzen Liter. Frank füllt die Flasche auf und auch diese schüttet er in großen Schlücken in sich hinein, wobei die Hälfte daneben läuft.

„Wie kann man solche Mengen auf einmal trinken?“, frage ich.
„Warte ein paar Minuten, der wird gleich kollabieren und alles auskotzen.“
„Was machen wir mit ihm? Wir können den ja nicht hier liegen lassen.“
„Nein, der muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, oder mal zumindest zu einem Arzt. Guck mal wie der aussieht, wir fahren ihn nach Djanet.“
Jetzt erst merke ich, wie verschrumpelt seine Haut ist, als hätte er zu lange in der Badewanne gelegen.
„Okay, wir fahren zurück nach Djanet. Am Besten legen wir ihn auf den Dachgepäckträger, da kotzt er uns nicht ins Auto. Ich setzte mich dazu, damit er nicht runter fällt.“
Frank hilft dem Afrikaner auf und ich klettere mit ihm über die Motorhaube auf den Dachgepäckträger des Landcruiser. Auf dem Dachgepäckträger haben wir eine Holzplatte montiert, auf der Frank nachts schläft. Rechts und links stehen zwei Alukisten, auf die ich mich jetzt setze und Frank reicht ihm eine alte, dicke Jacke, welche wir als Geschenk für Nomaden dabei haben, damit er sich gegen den kalten Morgenwind schützen kann.
Es scheint ihm besser zu gehen.
„Wo kommst du her?“, wollen wir wissen.
„Aus Nigeria.“
„Was ist passiert?“
„Wir waren 14 Männer, wir haben in Nigeria viel Geld bezahlt damit man uns nach Europa bringt. Meine Familie und meine Freunde haben ihr ganzes, gespartes Geld zusammengelegt. Wirklich alles, was sie hatten. Von Agadez fuhren wir mit einem großen Lastwagen durch die Wüste, mehrere Tage. Wenn wir was zu essen haben wollten, oder auch nur Wasser, mussten wir wieder viel Geld bezahlen. Dann mussten wir auf zwei Pick-up Geländewagen umsteigen. Wir fuhren in der Nacht und ohne Licht.
Plötzlich hielten sie an und wir mussten absteigen, mitten in der Wüste. Sie sagten, wir sollten immer weiter in dieselbe Richtung laufen, später würden wir dann Lichter sehen, die Lichter der Oase Djanet, es seien nur 30 km. Aber es war nichts zu sehen. Auch später nicht. Ich war noch nie zuvor in der Wüste und dann habe ich auch noch die Anderen verloren. Ich habe auch keine Lichter gesehen. Sechs Tage bin ich hier draußen herumgelaufen, mein Wasser war nach zwei Tagen aufgebraucht. Nach und nach habe ich mein gesamtes Gepäck weggeworfen, es wurde mir immer schwerer und unwichtiger. Ich habe nur die Plastiktüte mit dem Geld behalten.“
„Was hättest du in Djanet gemacht, wenn du angekommen wärst?“ Wir sind erschüttert. Ein Glück, dass wir noch mal umgedreht sind.
„Es gibt dort einen geheimen Treffpunkt, wo wir Wasser und Brot bekommen hätten. Jemand hätte uns weiter nach Tunesien geholfen und von dort weiter nach Italien. In Italien gibt es viel Arbeit und ich könnte Geld verdienen und davon etwas meiner Familie schicken, damit sie versorgt ist.“
„Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Kann sein, dass das Ärger gibt“, informieren wir den Verzweifelten.
„Ist mir egal, ich will nur nicht sterben. Ich bin so froh, dass es da draußen endlich vorbei ist, es war die Hölle. Ich dachte immer, ich muss sterben. Am Anfang hatte ich große Angst zu sterben, zum Schluss war mir alles egal, ich wollte nur noch, dass es aufhört.“
Wir fahren am Flugplatz vorbei, die Leute auf der Straße starren uns an. Das Zollgelände ist nicht weit entfernt, der Zöllner kennt uns noch von gestern. Er versteht die Situation sofort, gibt ein paar Kommandos an seine Mitarbeiter und setzt sich neben Frank auf den Beifahrersitz. Wir fahren am Camping des Hotels „Zeriba“ vorbei, am Marktplatz und auch am Krankenhaus.
„Frank, was ist los, das Krankenhaus ist links“, rufe ich von oben zur geöffneten Seitenscheibe hinein.
„Der Zöllner sagt, wir müssen erst zur Polizei.“
„Was soll das?“
„Keine Ahnung, er sagt, wir müssen!“
Die Polizeistation liegt einige Meter weiter auf der anderen Straßenseite. Das Tor zum Innenhof steht weit offen und so fahren wir direkt in den Hof. Ein gut genährter, uniformierter Polizist schlurft schwerfällig aus dem Gebäude.
Er guckt nicht gerade freundlich, eher wirkt er genervt, weil ihn jemand bei seinem Schläfchen oder bei der Teerunde stört. Die Begrüßung ist kurz, für arabische Verhältnisse schon fast unhöflich.
Der Zöllner wechselt mit dem Polizisten ein paar schnelle Worte auf arabisch. Wir verstehen kein Wort, denken jedoch, dass er die Situation erklärt.
„Willkommen sind wir hier nicht“, stellt Frank treffend fest.
Der dicke Polizist kommt zu uns ans Auto: „Los, runter da, du stinkender Neger, beweg dich!“
Dabei zerrt er dem Nigerianer am Jackenärmel so grob, dass die Naht aufreißt. Ich sehe Entsetzen in Franks Gesicht, mir geht es genau so.
Dann richtet er sein Wort an uns: „Warum habt ihr den Schwarzen eingesammelt? Lasst die Scheiße doch da draußen liegen. Wir haben jetzt wieder nur Arbeit mit dem Gesindel. Ich lass die Neger alle da draußen, wenn ich einen bei der Patrouillenfahrt sehe.“
In unfreundlichem Ton brülle ich zurück: „Finger weg! Fass ihn nicht an! Was soll das? Er ist ein Mensch und kein Hund. Zudem ist es meine Jacke, die du da zerrissen hast.“
Der vollgefressene Polizist lässt die Jacke los und geht einige Schritte zurück. Völlige Ruhe, keiner sagt etwas, wir gucken uns nur gegenseitig böse an. Obwohl sich inzwischen eine beachtliche Menschenmenge um uns versammelt hat, kann man das leise Quietschen der stählernen Eingangstür im Wind hören.
Frank unterbricht die Stille und wendet sich sehr sachlich an den Polizisten: „Wie ist hier die rechtliche Situation, was passiert mit ihm?“
„Er ist mein Gefangener. Ich werde ihn einsperren und wenn er Geld hat, mit dem nächsten Flugzeug abschieben. Wenn er kein Geld hat, kann er durch die Wüste zurück laufen.“
Natürlich hatte ich davon schon in den Medien gehört, dass festgenommene Migranten faktisch rechtlos sind und teilweise einfach in der Wüste ausgesetzt werden und dort umkommen. Doch glauben konnte ich ein so brutales Vorgehen bislang nicht. Und auch jetzt können wir beide nicht fassen, wie der fette Polizist, ohne jede Gefühlsregung ausspricht, dass er ihn verrecken lässt, wenn er den Rückflug nicht bezahlen kann.
Plötzlich habe ich wieder Bilder aus Béchar vor Augen. Vor fünf Jahren, als wir wegen illegalem Grenzübertritt inhaftiert waren, befanden sich in der Nachbarzelle ebenalls mehrere Schwarzafrikaner, die auf ihre Abschiebung warteten. Wie wird mit denen umgegangen worden sein? Ist der fette Polizist wohl eine Ausnahme? Unwahrscheinlich.
„Er muss dringend ins Krankenhaus, er wäre beinahe verdurstet“, unterbricht Frank meine Gedanken.
„Der braucht keinen Arzt, die sind zäh, los, runter vom Auto, du dreckiger Neger!“
Ich spüre die Angst des Afrikaners, der neben mir sitzt und zittert. Mir reicht es und ich wende mich an Frank: „Was willst du mit diesem fetten Rassisten diskutieren, das bringt doch nichts. Los, wir fahren ins Krankenhaus.“
Und zum Polizisten gewandt: „Wir fahren jetzt ins Krankenhaus und lassen ihn untersuchen. Der Arzt entscheidet, ob er haftfähig ist, oder nicht. Wenn du ihn jetzt verhaftest, informiere ich Amnesty International, Human Rights und alle Menschenrechtsorganisationen die mir einfallen. Ich werde alle Medien und Zeitungen informieren und deinen Namen werde ich überall ganz deutlich nennen. Ich werde alles daran setzen, dir hier den größten Ärger zu machen, den du dir nur vorstellen kannst.“
Die Antwort kommt prompt: „Wenn dir soviel an dem Neger liegt, nimm ihn doch mit nach Deutschland! Oder du und deine tollen Organisationen schaffen ihn zurück, aber ihr, in Deutschland, wollt die genau so wenig wie wir. Jede Woche kommen 20, manchmal 30 von denen hier in Djanet an. Wir haben die ganze Arbeit mit denen, nicht ihr. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter da draußen rumfahrt, werdet ihr noch mehr von der Sorte finden, halbverdurstet oder schon tot. Wenn ihr auch nur noch einen von denen zu mir in meine Stadt bringt, sperre ich euch ein, als Helfer von Menschenschmugglern! Ich warne euch. Hier habe ich das Sagen, nicht eure Presse.“
„Damit machst du uns keine Angst!“, lüge ich. „Wir fahren jetzt ins Krankenhaus.“
Frank startet den Motor und wir rollen langsam aus dem Hof zurück auf die Straße. Der Polizist bleibt stehen und lässt uns fahren. Die Menschenmenge läuft im Eilschritt neben dem Auto her. Ich frage den Nigerianer: „Alles klar? Der Polizist ist ein Idiot.“
„Ich bin so froh, dass ich lebe. Alles ist besser als die Wüste.“
Wir biegen auf den Hof des Krankenhauses. Die Nachricht hat sich schon verbreitet, denn ein Arzt erwartet uns bereits vor der Tür, ebenso drei Helfer mit einer Trage. Der Nigerianer wird vom Dachgepäckträger gehoben und ins Untersuchungszimmer getragen. Der Arzt untersucht ihn gründlich.
Wir stehen dabei und Frank sagt: „Geben sie ihm die gleichen Medikamente und die Aufmerksamkeit, die sie uns geben würden, wir zahlen alles.“
„Ich bin Arzt, ich mache keine Unterschiede. Das algerische Gesundheitswesen ist kostenlos, für alle, egal ob Europäer oder Afrikaner.“
Der Arzt schließt eine Infusionsflasche an seinem Arm an. Kurze Zeit später schläft der Afrikaner ein.
„Was wird mit ihm?“, fragt Frank den Arzt.
„Morgen wird es ihm deutlich besser gehen, aber außer Flüssigkeit zuzuführen, können wir nichts für ihn tun. Der Polizist wird ihn morgen holen und verhaften. Ich kann dann nichts mehr für ihn tun.“
„Was dann?“
„Er wird in sein Heimatland abgeschoben werden.“
„Wird man denn menschlich mit ihm umgehen? Der Polizist würde ihn doch am liebsten totschlagen.“
„Ich sage der Polizei nicht, wie sie ihre Arbeit zu machen hat, und die Polizei redet mir im Krankenhaus nicht rein“, erwidert der Arzt abgeklärt.
„Hier ist eine Plastiktüte voll Geld, die hat er da draußen für eine Flasche Wasser in den Sand geworfen. Geben Sie ihm die Tüte zurück, wenn er wieder klar denken kann!“
Wir verlassen das Krankenhaus und fahren zur Tankstelle, die verfahrenen Liter nachtanken.
An der Tankstelle ist niemand. Schließlich finden wir den Tankwart dösend auf einem alten, dreckigen Bett in einem noch älteren, noch dreckigeren Schuppen.
„Hallo“, der Tankwart blinzelt uns verschlafen an.
„Entschuldigung, wir möchten gerne tanken“, sagt Frank überaus freundlich, denn wenn er nicht aufstehen will, dann will er nicht und für uns gibt’s keinen Diesel.
„Generator schläft, kein Strom, bisschen warten, dann Pumpe läuft“, er dreht sich wieder um und zieht eine alte, dreckige Decke über den Kopf.
Frank und ich kennen Afrika, also nehmen wir es hin, wie es ist und setzten uns auf zwei Steine vor den Schuppen und warten.
„Eigentlich eine arme Sau, der kleine Schwarze.“
„Ja, der ist froh, dass er sein Leben hat, von Europa ist der geheilt“, kommen wir auf die Ereignisse des Morgens zurück.
„Aber wenn du die Zustände in seinem Land siehst, dann kannst du nur noch weglaufen. Ich würde es auch probieren.“
„Der Polizist war ganz schön wütend, hat mich gewundert, dass er sich nicht in den Weg gestellt hat, als wir zum Krankenhaus wollten.“
„Ach, der hatte vor uns genauso einen Schiss, als du ihm mit Presse und internationalen Organisationen kamst, wie wir vor ihm, als er uns drohte, uns wegen Menschenschmuggel zu verhaften.“
„Ja, vielleicht sollten wir noch mal zu ihm hin fahren, nicht dass er die Wut, die er auf uns hat, an dem Afrikaner auslässt. Vielleicht können wir ihn doch noch ein bisschen besänftigen.“
„Ja, die Idee ist gut, zum Abschied beschaffen wir dem Kleinen noch eine Essensration extra im Knast, mehr können wir dann aber wirklich nicht tun.“
Plötzlich krächzt ein Transistorradio in voller Lautstärke und in dem alten Schuppen brennt eine Glühbirne. Strom ist da. Und schon schlurft der Tankwart in seinen Badeschlappen zur Zapfsäule. Er tankt unseren Toyota randvoll, sodass der Diesel sogar im Einfüllstutzen zu sehen ist. Dabei grinst er uns unentwegt an.
Wir fahren zurück auf den Polizeihof. Frank stellt den Wagen ausnahmsweise mal nicht quer auf den Hof, sondern parkt ordentlich ein.
„Bevor wir da jetzt rein gehen, noch mal kurz zu unserer Strategie: Wir wollen kein Streitgespräch provozieren, sondern den Polizisten milde stimmen zum Wohle von unserem Freund“, ermahnt mich Frank.
„Okay, ganz kleine Brötchen backen und keine Presse“, grinse ich zurück und nicke.
Eine Polizeiwache führt uns ins Dienstzimmer des vor knapp zwei Stunden noch wütenden Polizisten. Scheinbar ist er einer der, oder vielleicht sogar DER Chef auf dem Polizeirevier.
Frank entschuldigt sich für unseren barschen Ton, dabei hätte er sich zu entschuldigen. Aber ich halte mich zurück, kleine Brötchen eben. Wir berichten aus dem Krankenhaus und dass er den Nigerianer wahrscheinlich morgen schon verhaften kann. Aber das weiß er schon alles, denn einer seiner Polizisten war schließlich die ganze Zeit dabei.
Aber es wirkt, er ist deutlich freundlicher und lässt sogar Tee und Datteln bringen. Er backt eben auch kleine Brötchen.
„Ihr wisst nicht, was hier vor sich geht. Wir haben riesige Probleme mit den Schwarzen, da kommen jeden Monat Hunderte illegal über die Grenze, alle wollen sie nach Europa.
Vor einem halben Jahr haben wir 140 Schwarze tot in der Ténéré-Wüste gefunden. Ihr Lastwagen hatte eine Panne und alle sind verdurstet.
Im Januar fanden wir 23 Tote und 27 Leute, welche die nächsten Stunden nicht überlebt hätten. Sie hatten sich verirrt, als sie unserer Grenz-Patrouille ausweichen wollten. Wie viele auf dem Lastwagen waren, weiß kein Mensch, wahrscheinlich liegen da draußen noch jede Menge Leichen, die noch keiner gefunden hat. Das ist aber auch egal, denn die Neger vermehren sich wie die Fliegen und sind genauso unnütz und genau so lästig.“
Sein Ton wird rassistischer, ich muss mich zusammenreißen um nicht wieder aggressiv zu werden und Frank geht es genau so. Schnell trinken wir den Tee aus und gehen.
Schweigend fahren wir aus der Stadt. Am Flughafen vorbei. Jeder hängt seinen Gedanken nach.
„Sag mal Frank, kennst du seinen Namen?“
„Nee, ich habe ihn nicht gefragt. Du?“
„Ich auch nicht.“




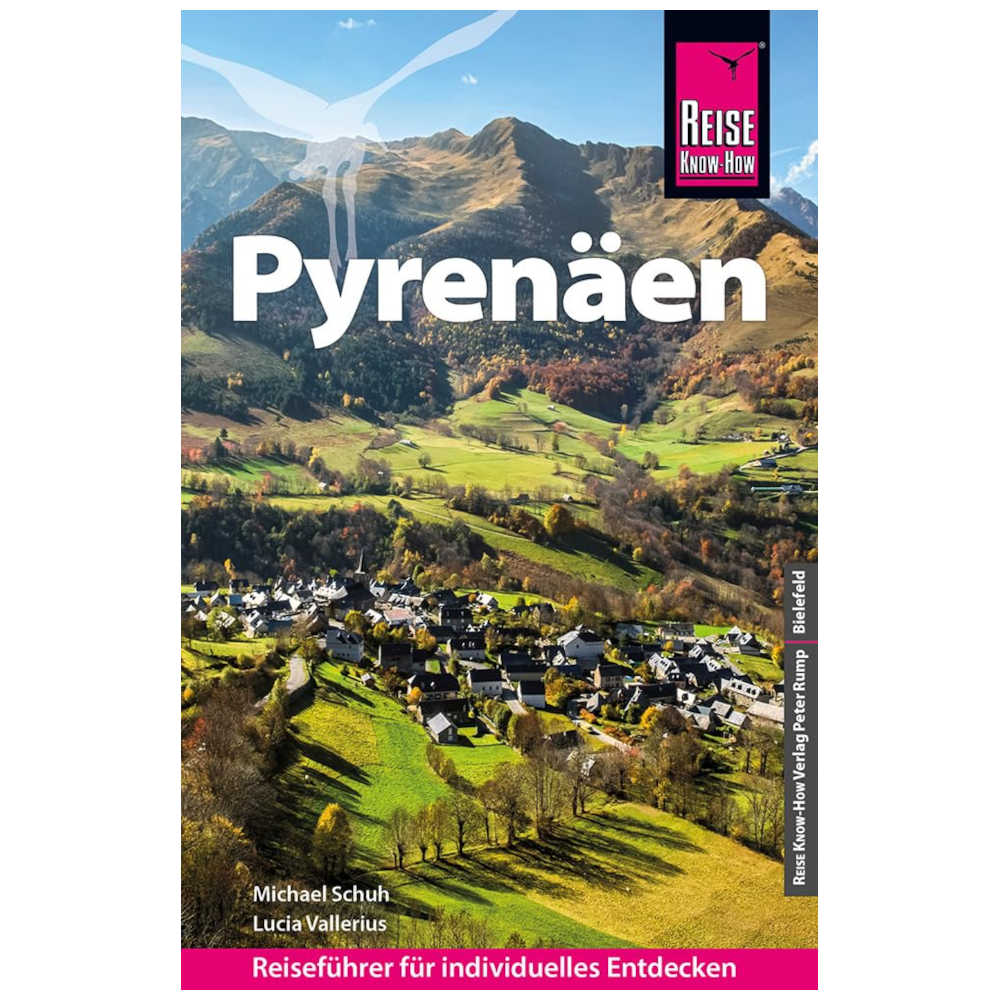
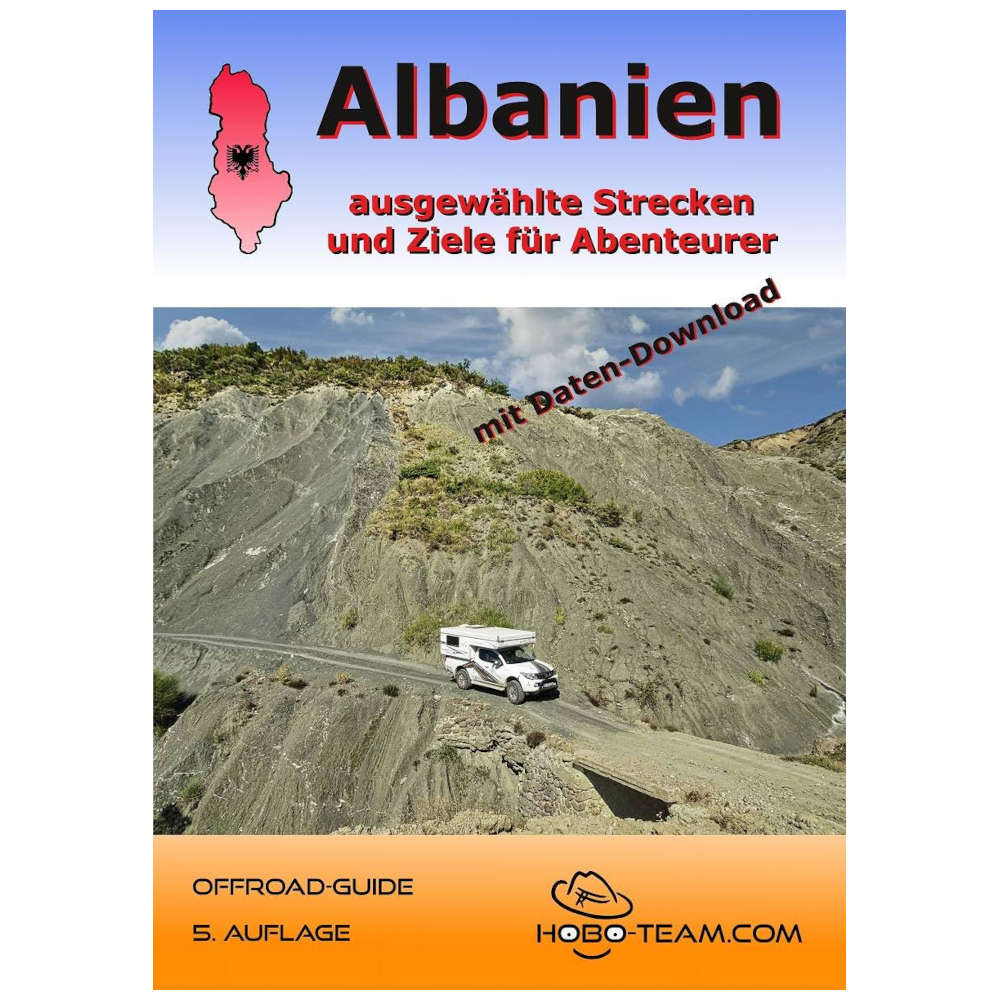
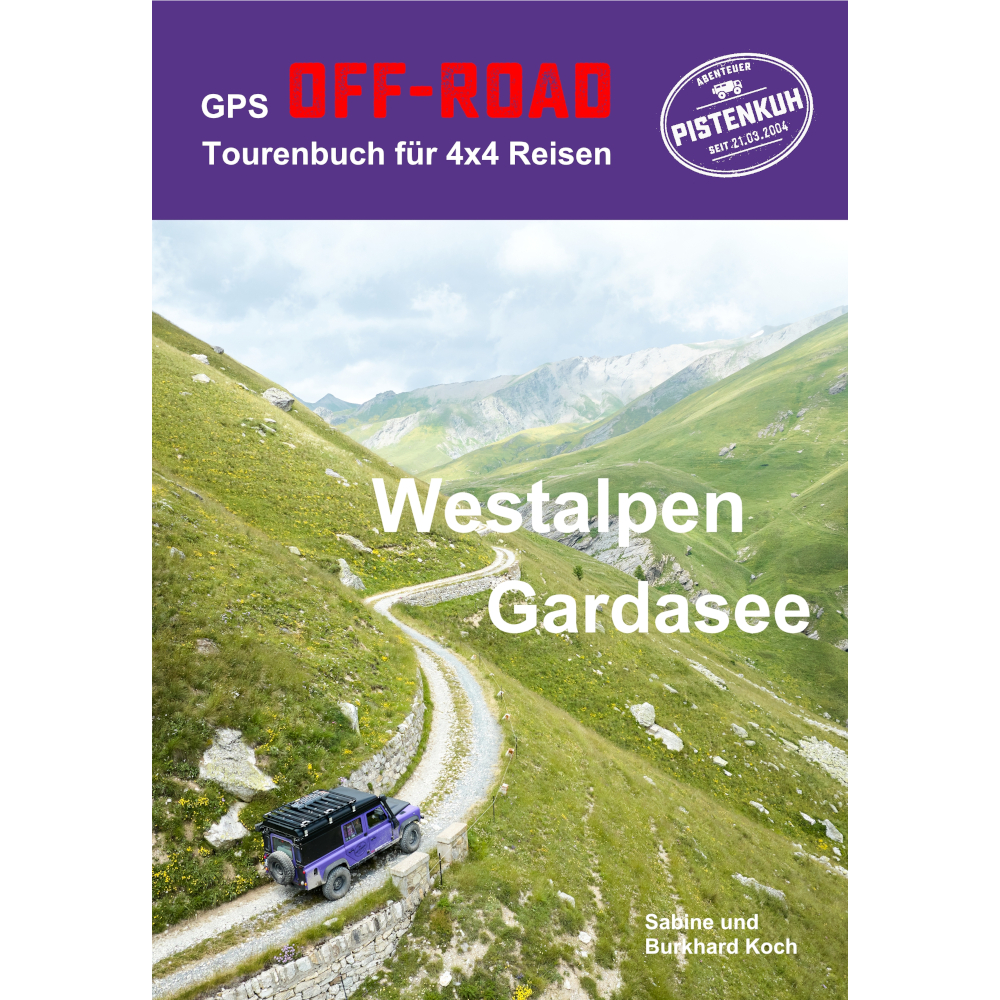

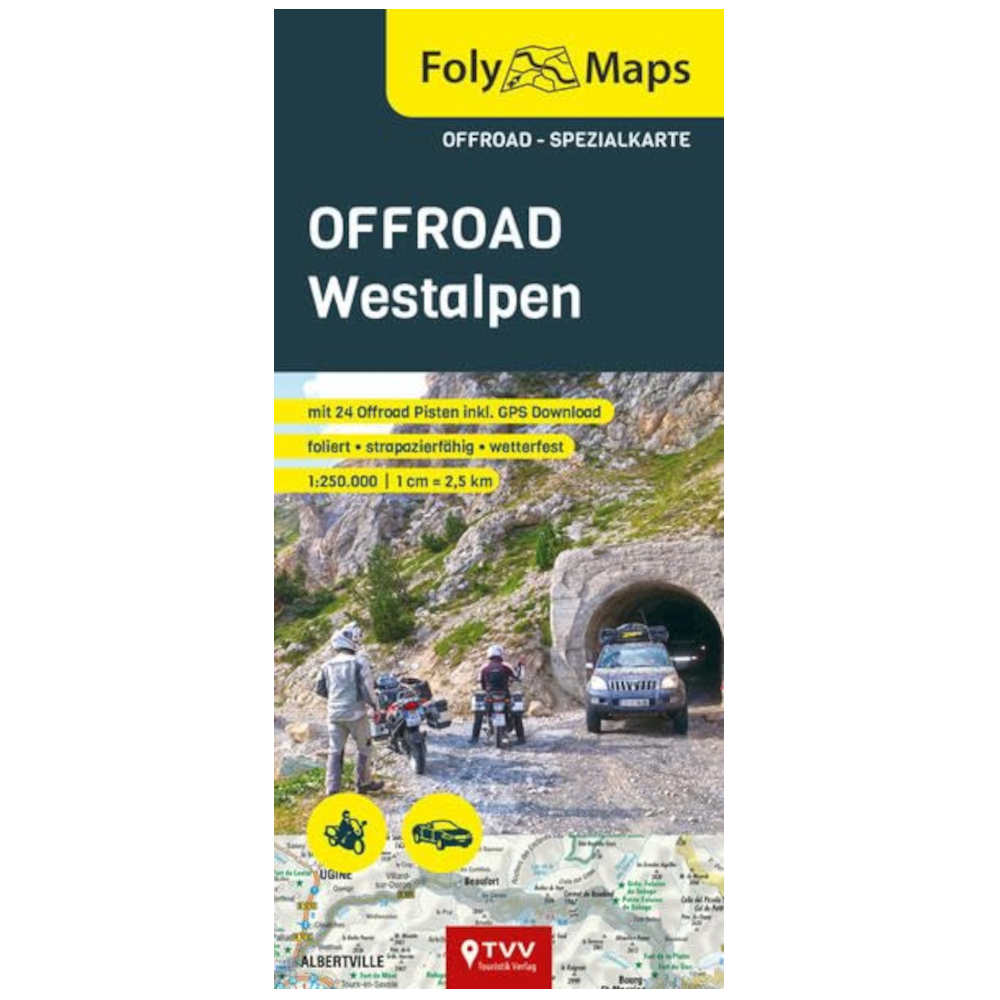





hallo pistenkuh
wieder eine schöne,spannende aber traurige geschichte.
leider gibt es rassismus überall auf der welt und fast überall
ist die ursache die gleiche……………..
gruss siggi
Uns ist vor vielen Jahren zwischen Djanet und Ghat was ähnliches passiert. Auch Nigerianer aber ein ganzer Trupp, relativ gebildete Leute. Eine Frau war auch dabei.
Die Schmuggler haben sie offensichtlich ganz bewußt in einem einsamen Seitenwadi abgesetzt – denen ist es wohl manchmal lieber ihre Kunden verrecken.
Wir haben die Afrikaner zur Hauptpiste gebracht wo alle paar Stunden ein Auto vorbeikommt, ihnen eine Karte zur Orientierung, Wasser und Nahrung für 2 Tage gegeben. Mehr kannst nicht tun. Heute wäre man vermutlich schneller wegen human trafficking dran als damals…
Wir hatten mit einem von den Leuten noch eine Weile Kontakt. Ein paar Jahre hat er in Libyen gearbeitet und später dann nach Italien übergesetzt.
Da hat sich über die letzten 500 Jahre nix geändert. Wir sind aktuell in Ostafrika unterwegs und sehen da noch die Überreste vom Sklavenhandel z.B. die Mangobäume die entlang der Sklavenrouten heute noch wachsen. Der „Westen“ arbeitet sich selbst am „Sklaven-Thema“ ab und merkt dabei nicht, dass Afrika selbst, die Araber, Indien und China eine viel schlimmere Bürde zu tragen hätten ….
Grüße aus Uganda
EDI&CORDY