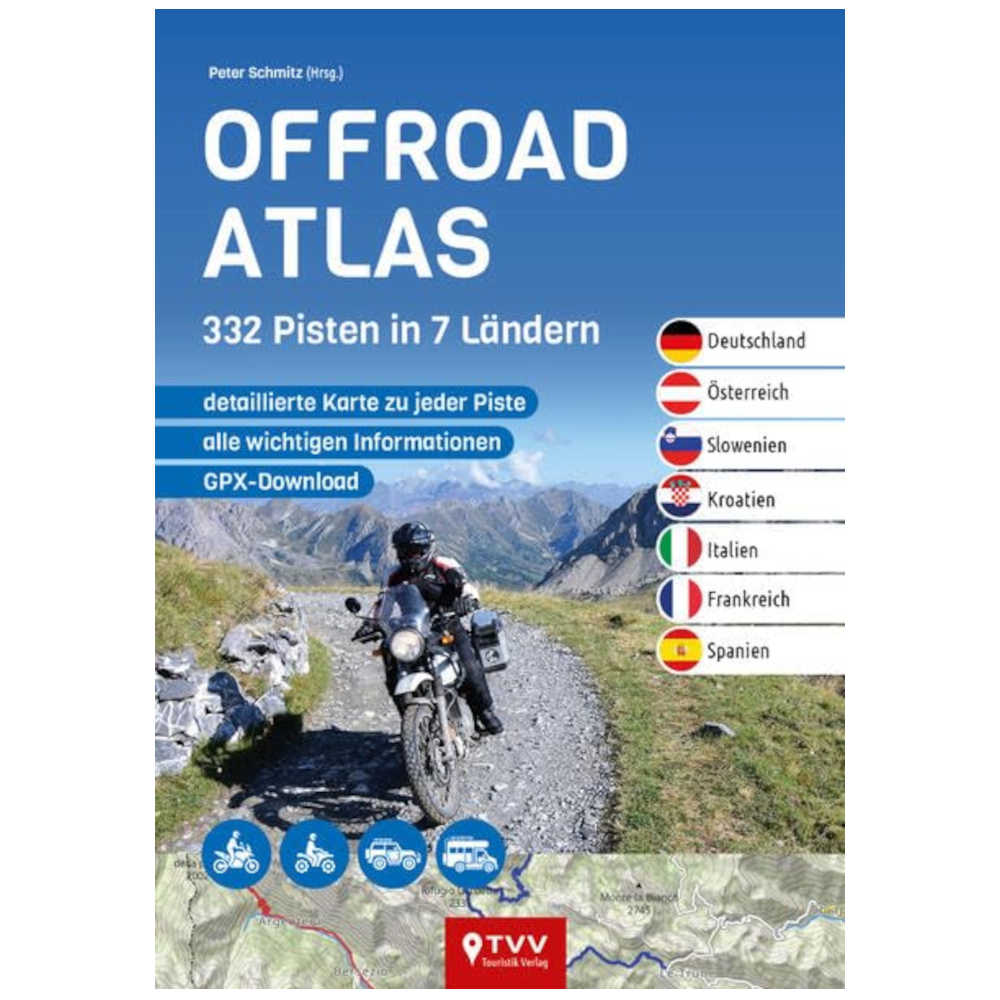Mosambik
Erst mal ist Mosambik teuer. 25 US-Dollar Visum pro Person und dann 100 US-Dollar Road-Tax. So sehr ich mich wehre und verhandle, keine Chance. „You pay! We need your Money.“ 150 Dollar ärmer machen wir uns auf den Weg. Gute Straße, wenig Verkehr, freundliche Menschen, es macht Spaß in Mosambik zu reisen.
Fünf Kisten Bier
Tage später erreichen wir die Küste, na ja nicht wirklich, an die Küste kommt man nicht ran. Die Strände sind unberührt, weil keine Straße, oft noch nicht einmal ein Weg an den Strand führt. Die Hauptstraße verläuft 10-30 Kilometer im Hinterland. So sind die Traumstrände zwar vorhanden, aber unerreichbar. In Chindenguele bahnen wir unseren Weg durch den Palmenwald.
Zwei Bäume müssen gefällt werden und eine kleine Palme reißen wir mit der Seilwinde aus, als wir im Sumpf stecken bleiben. Drei Stunden später stehen wir am Strand. Der Flurschaden interessiert hier niemanden, aber dennoch würden wir gerne den Schaden begrenzen. Sollte es das Projekt „Saufen für den Urwald“ der Krombacher Brauerei noch geben (für jede Kiste Bier werden ein paar qm Urwald gerettet), könnt ihr helfen, den Schaden auszugleichen. Ich denke, nach fünf Kisten Bier steht die Palme wieder.
Babies zu verkaufen
Muxungue, die Stadt ist bunt, typisch afrikanisch. Am Straßenrand reihen sich fast 20 kleine Restaurants aneinander, mit je einem Plastiktisch und vier Stühlen, die Stühle aus Holz geschnitzt, unter einem Schattendach. Auf der Straße wird auf Holzfeuer gekocht. In drei bis fünf großen Alutöpfen köchelt Cassava, Spagetti, Reis und verschiedene Soßen. In einer Pfanne wird Fisch frittiert und der Duft des Frischgebratenen mischt sich mit Feuerqualm und Dieselabgasen. Dazu überlaute, völlig übersteuerte Musik aus riesigen Lautsprechern. Ich muss ein Sprung beiseite machen. Der Radfahrer mit einer Frau auf dem Gepäckträger, diese ein Baby auf dem Rücken und eine Plastiktüte in der Hand, am Fahrradlenker auf jeder Seite zwei lebende Hühner, mit den Beinen zusammengebunden und auf der Stange einen Samsunite-Reisekoffer, hätte mich sonst überfahren, denn Bremsen hat sein Gefährt nicht. Mit der Nummer wäre er in Deutschland im Zirkus – oder im Knast. Aber nur ich drehe mich nach ihm um, für alle anderen ist es normal, sie sind ja schließlich genauso unterwegs. An die Restaurants schließen sich die Straßenhändler an. Der eine handelt mit Tomaten, der andere mit Zahnpasta, dazwischen Fahrradpedale und Gürtelschnallen. Plastiktöpfe aus China, Altkleider aus Europa, Seife, Cola, Mausefallen, Zucker, Autoreifen, Mehl, Fanta, Raubkopien, Hühner, Kaugummi, Brot, BHs, Holzkohle, Babies, Par… Babies? Ich bleibe verdutzt stehen. Die Marktfrauen schreien, reißen ihre mitten im Sortiment schlafenden Babies an sich und lachen.
Bananenkauf
Hellgelb schlängelt sich das Erdsträßchen durch die sanfte Hügellandschaft und bildet einen Farbkontrast zu dem in dieser Jahreszeit grau-braun wirkenden Busch. Der Staub und Dunst in der Luft lassen alle Farben blass wirken. Selbst die Sonne steht als fahl gelbe Scheibe am grauen Himmel und die saftig grünen Bananenstauden wirken farblos. Das Wegelchen ist auf keiner Karte eingezeichnet, aber es verläuft genau in Richtung Nord und das ist ganzgenau unsere Ziel-Richtung. Wir haben keine Ahnung, ob und wo die Off-Road-Piste wieder auf eine in unserer Karte eingezeichnete Straße trifft. Vielleicht endet es auch irgendwo, oder ändert die Richtung, aber Umdrehen können wir ja immer noch. Es geht vorbei an kleinen Hütten, die aus Ästen und Gras gebaut sind und ganze Großfamilien beherbergen. Überall wird mit hölzernen Mörsern Cassava gestampft. Gekocht wird auf Feuer, Hühner rennen herum und kleine Schweinchen. Und natürlich jede Menge, seit Tagen ungewaschene Kinder. Vor einer Hütte ist ein kleiner Verkaufsstand aufgebaut.
Frisch geerntete Bananen liegen in Fünfergruppen neben frischen Ananas. Ich stoppe den Deutz und ein paar ältere Kinder kommen angerannt, während die kleinen angstvoll ins Haus rennen, oder sich hinter der Mama vor dem weißen Mann verstecken. „Was kosten die Bananen?“ „Ein Metical.“ Okay, der Preis ist genau wie auf dem Markt. Fünf Bananen macht fünf Meticais, rechne ich und gebe dem Jungen eine 5 Meticais-Münze. Sabine packt fünf Bananen ein und die Mutter gibt mir 4 Meticais zurück. Fünf Bananen für einen Metical? Ja, so preiswert ist das Leben auf dem Land. Für einen Euro gibt es bei der Bank 40 Meticais und dafür auf dem Land 200 Bananen.
Schulbesuch in Mosambik
Kokosnusspalmen und Bananenstauden soweit das Auge reicht. Dazwischen kleine Dörfer und Hüttenansammlungen. Die Dorfschulen sind primitiv. Eine Tafel im Schatten eines großen Baumes, davor kleine Plastikstühle oder umgedrehte Wassereimer, auf denen die Schüler dem Unterricht folgen. Eine Klasse besteht aus 80 bis 100 Schülern und einem Lehrer. Mit einem schlechten Gewissen stören wir den Unterricht, ich möchte gerne ein paar Fotos machen und vorher die Klassenlehrerin um Erlaubnis bitten.
Die Kinder folgen weiter dem Unterricht, schielen zu uns herüber, aber keines lässt sich anmerken, dass es unkonzentriert wäre. Die Schüler sind absolut ruhig, eine solche Disziplin haben wir noch nirgends in Afrika erlebt. Wegen der Filmerlaubnis verweist uns die Lehrerin an den Schulleiter, der auch schon auf uns zu kommt. Filmen, kein Problem, er spricht ein paar Worte zu den Lehrern und zwei Minuten später stehen alle Schüler der Schule (vier Klassen) geordnet auf dem Schulhof und singen die Nationalhymne. Anschließend ein Volkslied mit Tanzeinlagen und mit höchster Ruhe und Disziplin geht es zurück auf die Plastikeimerchen und der Unterricht geht weiter. Mal eine Frage an die Schulleiter unter euch: Was wäre, wenn ein Tourist aus Mosambik plötzlich im Lehrerzimmer steht und eine deutsche Klasse fotografieren wollte?
Highspeed in Mosambik
Wir hatten Glück, die Off-Road Piste endet nach knapp 90 Kilometern auf einer Teerstraße. Die Tachonadel steigt bis an die 80iger Marke. Ein ISUZU Pick-up überholt uns, schaltet die Warnblinkanlage ein und bremst uns aus. Ich stoppe am Straßenrand und ein Weißer kommt an meine Tür. „Hi, ich bin Martin, ich kenne euch oder besser gesagt eure Pistenkuh aus dem Internet und vom Willy-Jansen-Treffen.“ „Und was machst du hier.“ „Ich arbeite hier, wir haben dahinten unser Baucamp, kommt doch mit, ich lade euch zu einem Bier ein.“ Beim Bier erfahren wir, dass Martin im Jahr 2005 mit einem Unimog die Ostseite runter gefahren ist. Irgendjemand hat ihn in Mosambik angesprochen, ob er sich mit Unimogs auskenne und da Martin KFZ-Meister ist, hat man ihm einen Job als Projektleiter angeboten. Seitdem durchzieht er mit seinem Team, bestehend aus einem Caterpillar, einem Radlader, einem Lastwagen, jede Menge Haken und Schaufeln und noch mehr Arbeiter, Tansania, Mosambik und Südafrika. Wir haben das Team schon am Straßenrand bemerkt und auch die riesigen, armdicken Wasserschlauchrollen. „Ist das ein Entwicklungshilfeprojekt?“, will ich wissen. „Ist ja klasse, dass endlich sauberes Wasser zu den Menschen gelegt wird. Oder sind es Stromkabel?“ „Nein, wir verlegen keine Wasserleitung, das sind Glasfaserkabel für Highspeed-Internet. Wir schließen Mosambik, Zimbabwe und Tansania ans Seekabel in Südafrika an. Ich arbeite für Alcatel und Lucent-Technologies. “ Was für eine irre Welt. Da sitzen Menschen in Hütten aus Lehm und Stroh, haben mehr als 10 Kinder, holen Wasser aus dem Wasserloch mit Eimern auf dem Kopf, der nächste Stromanschluss ist 50 Kilometer entfernt. Ob die ahnen, wenn sie abends im Schein des Holzfeuers sitzen, dass 1,20 Meter unter ihrer Hütte die Daten der Welt durch ein armdickes Glasfaserkabel rasen. Eine irre Welt.
Die Ausnahme
Unsere kleine Erdstraße endet am Shire-Fluss und die Informationen, ob die Fähre funktionstüchtig ist oder nicht, sind widersprüchlich. Sollte die Fähre auf dem Grund liegen, wäre es nicht tragisch, die Alternativpiste müsste durch schöne Landschaft führen, danach sieht es zumindest auf der Landkarte aus. Die Fähre funktioniert und ich traue ihr auch zu, unsere 10 Tonnen auf die andere Seite zu bringen. Der Dieselmotor ist zwar schrott, aber den Fluss überspannt jetzt ein Stahlseil, an dem man das Floß per Muskelkraft hinüber zieht. Preisverhandlungen beginnen. Wir erinnern uns: 50 Meticais ist der Tageslohn eines Arbeiters, oder der Gegenwert von 250 Bananen, oder 1,20 Euro. Der Fährmann verlangt 500 Meticais, also 2500 Bananen. Ich biete 200, da ist schon die Touristenzulage von meiner Seite eingerechnet. Jetzt stellt sich heraus, dass ich gar nicht mit dem Fährmann verhandele, sondern mit einem hergelaufenen Haiopai, der jetzt anbietet den Fährmann aus dem nahegelegenen Dorf zu holen.
Für diese Dienstleistung will er 50 Meticais extra. „Du kleiner Drecksack, dir verpasse ich ein Extra-Arschtritt“, denke ich mir und biete ihm 250 Meticais für folgendes Komplettpaket: Den Deutz mit der Fähre über den Fluss und Sabine mit der Kamera zuvor mit einer Piroge auf die andere Seite schaffen, damit sie die Aktion filmen kann. Wie viel er dem Fährmann und dem Pirogenfahrer zahlt, ist seine Sache, die Differenz kann er sich einstecken. Ich hätte es mir denken können, das ist alles zu kompliziert. Dafür erfahre ich ganz nebenbei, dass der richtige Fährmann in Sichtweite im Schatten eines Baobabs sitzt. Von wegen für 250 Bananen aus dem Dorf holen. Wir werden uns nicht einig, 300 Meticais ist das letzte Wort des Fährmanns, 250 mein letztes Angebot und so starten wir den Deutz und legen den Rückwärtsgang ein. Genau damit habe ich gerechnet, der Fährmann erhebt sich und kommt an meine Fahrertür. „Pass auf, jetzt geht’s für 250 über den Fluss“, sage ich vorausahnend zu Sabine. „Ich habe heute noch kein Geschäft gemacht und habe Hunger, hast du keine Rolle Biskuits für mich, oder eine Packung Spagetti?“ „Fahr mich rüber und du kannst 1250 Bananen essen.“ Breites Grinsen im Gesicht des Fährmanns und er geht zurück in den Schatten unter den Baobab. Wir fahren. Auf einer gerade fahrzeugbreiten Piste geht es weiter durch den Busch. Die Kompassnadel zeigt für die nächsten 120 Kilometer Richtung Nord-Ost und nach zwei Tagen ist der Grenzübergang zu Malawi erreicht.
Die härteste Nuss Afrikas
Milange, der Ort bietet nicht viel. Aber es gibt eine Tankstelle und so verwandeln wir unser restliches mosambikanisches Geld in Diesel. Die Grenzbeamten sind korrekt, alles geht schnell und freundlich, aber der Schlagbaum öffnet sich nicht. Ein Mann in Uniform bittet mich ins Büro des Road-Tax-Found Ministerium. Wir nehmen es gelassen, zücken die Quittung der gezahlten 100 USD bei der Einreise und glauben noch, in wenigen Minuten unsere Fahrt fortsetzen zu können. „Diese Quittung gilt nur für die Strecke im Süden nach Maputo. Hier müsst ihr 125 USD Road-Tax zahlen.“ Dass die Road-Tax doppelt kassiert wird, haben wir schön öfters gehört, vor allem in der Gegend um Beira. Bei der Einreise versicherte man uns, dass die Road-Tax nur einmal gezahlt werden muss. Also verweigern wir die Zahlung. Langes hin und her, letztendlich werden wir zurück in die Stadt, zum Chef des Road-Tax-Found der Nordregion eskortiert. Das arrogante Arschloch macht kurzen Prozess und beschlagnahmt mit Polizeigewalt unseren Deutz. Wir müssen ihm das Carnet de Passage (Zolldokument fürs Auto) aushändigen und bekommen es erst bei Zahlung der 125 USD zurück. Unsere Pistenkuh können wir jedoch innerhalb der Stadt bewegen und uns ein Camp suchen. Verhandlungen sind nicht möglich, egal, ob ich an seine Hilfe und Gnade appelliere oder meine guten Kontakte zu Ministern anklingen lasse, die ich leider gar nicht habe. „You Pay!“ Angeblich muss er arbeiten, die Diskussion ist beendet und ich werde aus seinem Büro geworfen. Als „Gnadenakt“ ohne es wirklich zu müssen, wie er betont, gibt er mir die Telefonnummer und den Namen seines Vorgesetzten, ein Minister in der Hauptstadt Maputo. Der ist wirklich ein hohes Tier, der Vorgesetzte in Maputo ist für uns nicht zu sprechen und wird für uns auch nie zu sprechen sein, so seine Sekretärin. Der weitere Weg wäre der, dass wir einen Anwalt konsultieren. „Okay, dann machen wir das.“ So schnell geben wir nicht auf. Einen Anwalt finden ist nicht so einfach und einen der sich mit einem Ministerium anlegen will, schon mal gar nicht. Von dem einzigen Anwaltsbüro das wir in der Stadt finden, werden wir mit folgendem Argument abgewimmelt: Die Angelegenheit würde nicht hier, sondern in Maputo verhandelt, dazu müsste unser Anwalt jedes Mal nach Maputo reisen was enorme Kosten für Flug und Hotel verursachen würde. Besser wäre es, wir würden selbst nach Maputo reisen und uns dort einen Anwalt suchen, der mit solchen Streitigkeiten auch besser vertraut wäre. Maputo, das wären mal gerade 2.200 Kilometer zurück. Wir dürfen mit unserem Auto die Stadt nicht verlassen, zudem gilt unsere Aufenthaltserlaubnis (Visum) nur noch 4 Tage. Den ganzen Tag gekämpft, am Abend, kurz bevor die Grenze schließt, geben wir uns geschlagen. Wir zahlen.
Abschließend zu Mosambik: Traumhafte Strände, die nicht zu erreichen sind. Insgesamt 275 USD für Visa und Straßenbenutzungsgebühren, obwohl wir zu 80 % Buschpisten gefahren sind, legen den Schluss nahe, dass die Regierung keine Touristen, wie uns wünscht. Wir brauchen Mosambik auch nicht noch einmal und werden zukünftig einen Bogen um Mosambik machen. Leid tut es uns um die Einwohner, wirklich freundliche, nette Menschen.