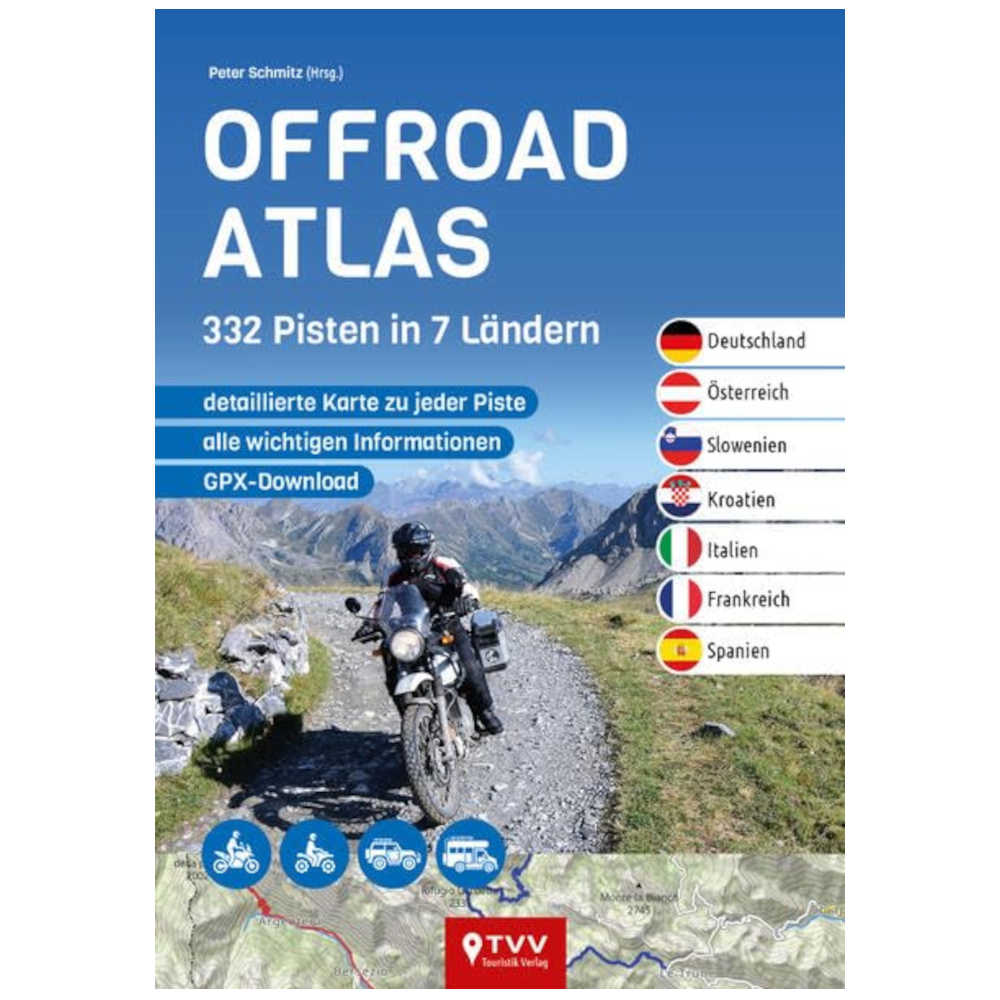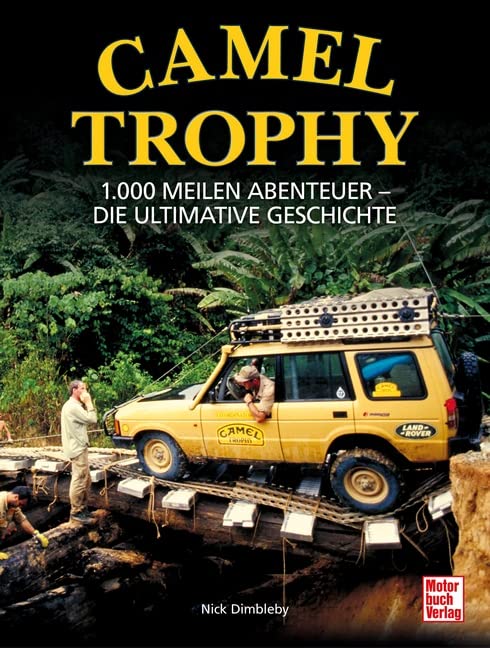Grill-Imbiss im Schlaraffenland
Kleiner Grill-Imbiss auf der Great Central Road
Uluru (Ayers Rock) und Kata Tjuta (Olgas) sind schon lange im Rückspiegel verschwunden. Die Great Central Road, von den Australiern hat sie den Beinamen „Die längste Abkürzung“ bekommen, zieht staubig durch flaches Land.
Warburton steht auf der Landkarte, doch die Piste macht einen weiten Bogen um den Ort. Im Bogen liegt das Roadhouse und von hier führt eine kleine geteerte Zufahrt zur Warburton-Siedlung, eine Aborigine-Siedlung. Für Fremde ist der Zutritt verboten.
Am Roadhouse, eine Tankstelle mit kleinem Laden und warmer Theke, in der gegrillte Hähnchen, Pommes und Hot Dogs liegen, war ganz schön was los. Zerbeulte Autos mit eingeschlagenen Scheiben, darin fünf bis acht Personen, dreckig, zerlumpt, zerzaust, fahren vor und kaufen Take Away Mittagessen für die ganze Familie, wie jeden Mittag. Natürlich auch hier Fotografierverbot.
Diesel und Wasser haben wir noch genug, also halten wir uns nicht lange auf und fahren weiter Richtung West. Schnurgerade zieht die Piste durch den Busch, kein Verkehr, keine Attraktion, die einzige Abwechslung sind gelegentliche Autowracks am Pistenrand.
Kaspar Hauser der Aborigines
„Steht da einer und winkt?“, fragt Sabine ungläubig. Genau können wir noch nicht erkennen, was sich mitten auf der Fahrbahn am Horizont bewegt. Doch beim Näherkommen ist es klar, am Straßenrand steht ein verbeulter Holden, Lagerfeuer brennt, im Schatten eines Baumes sitzen zwei Männer und eine Frau. Ein Aborigine auf der Straße gibt Handzeichen zum Anhalten. Klar halten wir an, was sollte man hier draußen auch sonst tun. Das rechte Hinterrad ist völlig zerfetzt. Viel interessanter ist jedoch, was neben dem Lagerfeuer liegt. Drei große Echsen, zwei grüngelb gemusterte und eine blauschwarze. Noch interessanter sind die drei Aboriginies unter dem Baum. Schwarze, richtig schwarze Haut, einer hat sich mit Lehm und Asche Streifen ins Gesicht gemalt, seine Haare sind total zerfilzt, Hornhaut unter den Füßen, zerrissene, zerschlissene, fleckige, bekleckerte Jogginghose und T-Shirt.
„Das muss der Kasper Hauser der Aboriginies sein“, geht es mir durch den Kopf. Das erste Mal, dass wir einem solchen Menschen begegnen, nicht bei den Himbas in Namibia, nicht bei den Hamer, Mursi und sonstigen Stämmen in Äthiopien. Der Mann neben ihm, nicht ganz so wild, wird gerade von der Frau gelaust. Sie sehen aus, als hätten sie Jahre unentdeckt in einer Höhle gelebt. Wahnsinn! Von uns nehmen sie keine große Notiz, ein kurzes Nicken zur Begrüßung muss genügen. Ihr Blick bleibt auf dem Boden gerichtet, Augenkontakt ist in ihrer Kultur eine intime Sache, wie bei uns ein Kuss. Kasper Hauser kriecht zum Feuer, schiebt die brennenden Äste beiseite und vergräbt die drei kompletten Echsen so in der Glut, dass nur ihre Schwanzenden etwa 4-5 cm aus dem Gluthaufen heraus gucken.
Der Fahrer öffnet den Kofferraum, holt ein Reserverad, das bis auf das Stahlgewebe abgefahren ist und einen dicken Känguruschwanz ans Tageslicht, der direkt mit Haut und Haar ins Feuer gelegt wird. Die Verständigung ist schwierig, der Fahrer spricht etwas englisch. Von den Anderen weiß ich es nicht, sie sprechen nicht mit uns. Sie lausen sich gegenseitig ohne uns zu beachten. Ich hole Wagenheber und Werkzeug aus unserem Land Cruiser und eine Wasserflasche für die drei. Ein knappes „Thank You“ und die Wasserflasche geht im Kreis. Wir müssen unseren Cruiser fast komplett ausladen, denn der Reservereifen ist platt und unser Luftkompressor in der hintersten Ecke verstaut. Aufpumpen reicht nicht, zwei Löcher sind zu flicken. Also Flickzeug raus und an die Arbeit. Reifen und Echsen sind fast gleichzeitig fertig. Am Schwanz werden die verkohlten Tiere aus der Glut gezogen.
Im Schlaraffenland
Ich will probieren. Wir hocken alle im Kreis und Kasper Hauser legt mir eine der grüngelben, jetzt jedoch fast mattschwarz verkohlten Echsen vor mich, als sei es das normalste der Welt. Die anderen drei sehen mich erstaunt an, als hätte ich ihnen offenbart, ich sei Aborigine. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding isst und sehe fragend in die Runde. Das scheint sie zu amüsieren, sie spaßen und lachen. Ich kann mir denken, was in ihren Köpfen vorgeht. „Was sind die Weißen blöd, da sind sie im Schlaraffenland, wo ihnen die gebratenen Echsen in den Mund springen und die würden verhungern.“
Die Frau hat Erbarmen, nimmt das Tier, reißt den Hinterlauf ab und gibt mir den Schenkel. Das weiße Fleisch ist fest und schmeckt wie Krokodil. Man kann es auch mit Huhn vergleichen, die Haut ist jedoch im Vergleich zu Huhn dicker und zäher. Sabine möchte auch ein Stück und so teilen wir uns den Echsenschenkel.
Kasper nimmt seine Echse, beißt ihr mit seinen Eckzähnen in die Bauchdecke und reißt sie auf, wie wir es mit Chips- oder Gummibärchentüten machen. Das wäre mein Bild. Die Nachmittagssonne steht genau richtig, das Feuer lodert und der originalste Aborigine in Festbemalung reißt mit seinen Zähnen die Echse in Stücke. Die Fotoausrüstung bleibt im Auto, wir wollen die Situation nicht kaputtmachen und ich verabschiede mich von dem Gedanken, irgendwelche Fotopreise gewinnen zu können. Der geflickte Reifen ist schnell montiert, unser Werkzeug eingepackt und alles startbereit. Ich traue der alten Karkasse nicht über den Weg und schlage vor, dass wir sie zurück nach Warburton begleiten, für den Fall, dass ihnen das Ding um die Ohren fliegt. Vierzig, bzw. 80 km kosten uns 10 Liter Diesel und das ist es uns wert, die „Wilden“ im Kreise ihrer Familie zu wissen, mit der sie in den nächsten Tagen irgendeine Zeremonie feiern oder zelebrieren wollen. 800 Meter, und der Reifen ist platt. Da kann man auch nichts mehr machen, in der Flanke klafft ein 6 cm langer Riss.
Im Toyo stinkt’s nach gegrillter Echse
Hätte ich geahnt was kommt, hätte ich es nicht getan. Aber so schlage ich vor: Wir laden das kaputte Rad in unseren Toyo, Sabine steigt nach hinten und gibt den Beifahrersitz frei. Wir bringen den Fahrer mit dem Rad nach Warburton. Dort ist seine Familie, die organisieren einen Reifen und wir bringen ihn zurück zu seinem Auto und den Wartenden. Die Fahrt beginnt. Die Verständigung bleibt schwierig, zur Zeremonie erzählt er nichts. Dann greift er in seine Hosentasche, und zieht eine gegrillte Echse hervor. Keine Ahnung, wo er die her hat, in der Glut hatte ich nur drei gesehen, aber es muss wohl für jeden Eine gewesen sein. Er bricht die Echse wie ein Mettwürstchen einfach in der Mitte durch. Fett spritzt an die Windschutzscheibe. Der Darminhalt tropft auf seine Hose, es stinkt bestialisch. Die halbe fettige Echse wirft er aufs Armaturenbrett, ohne Rücksicht auf die dort liegende Landkarte. Die andere Hälfte isst er, nennen wir’s mal essen. Fett und stinkender Inhalt tropft aus dem Tier. Man hätte sie vor dem Grillen ausnehmen sollen. Ich will Sabine noch um eine Serviette bitten, denke aber, dass man wohl Echsen im Busch nicht mit Serviette isst und lasse es bleiben.
Das Vieh wird wie folgt verspeist. Er beißt einfach den Kopf ab, kaut drauf rum, spuckt Knochensplitter, Hautfetzen und sonstiges Ungenießbare in seiner Hand und wirft es zum Fenster raus. Und der nächste herzhafte Biss in den kleinen Imbiss. Gleiches Prozedere. Zum Schluss schmiert er seine Hände an sein T-Shirt. Im Auto stinkts, ich könnte die Scheiben einschlagen, um möglichst viel frische Luft zubekommen. Die Tachonadel steht inzwischen knapp über der 100ter Marke, ich will so schnell wie möglich die Fahrt hinter mich bringen. Er greift zur verbliebenen Echsenhälfte auf dem Armaturenbrett und bietet sie mir an. Mit einem aufgesetzten Grinsen lehne ich ab und das halbe Tier fliegt zum Fenster raus.
Wir sollen zum Roadhouse fahren. Während er im Laden verschwindet, lade ich das Rad aus, doch die Fahrt ist hier nicht zu Ende. Er hat sich nur eine Dose Cola gekauft. Also lade ich das Rad wieder ein und es geht ins Dorf, das normalerweise für Fremde nicht zugänglich ist. Seine Familie lebt in einem baufälligen Holzhaus ohne Fenster, ohne Tür. Alle bisher zur Zeremonie angereisten Familienmitglieder hausen in Zelten, die sie aus alten Planen und Pappkartons gebaut haben. Müll überall, alte Autos, alte Kühlschränke, klein geschlagene Möbel, demolierte Kinderwagen. Auf der kurzen Fahrt zwischen Roadhouse und Zeltlager erklärt er uns, dass wir ihn nicht mit zurück nehmen müssen. Er will erst schlafen und sich dann mit seinem Bruder um alles Weitere kümmern. Booh, was sind wir froh. Er steigt aus, nimmt sein Rad, sagt kurz „Thank you“ und verschwindet ohne sich noch mal umzudrehen in der Baracke. Hofften wir zu Beginn noch, mehr Einblick zu bekommen, sind wir jetzt heilfroh, nicht ins Haus zu irgend einem Getränk oder Mahlzeit geladen zu werden.
Die Wartenden nehmen die Nachricht, dass ihr Angehöriger erst mal Schlafen will, völlig gelassen hin. Das Lagerfeuer brennt schon wieder und die erste tote Echse liegt bereits im Dreck daneben.
Einfach ein Schlaraffenland.